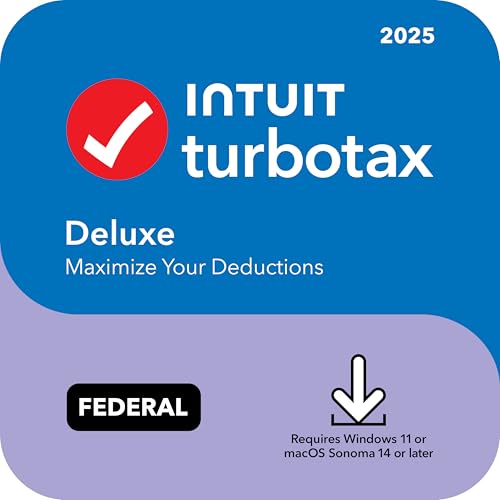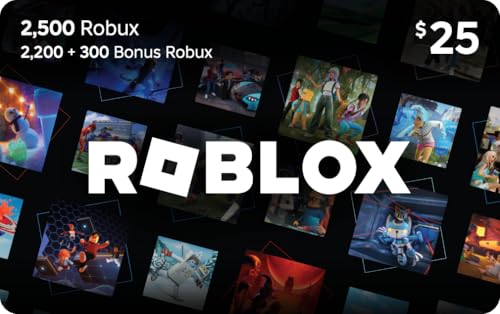Player FM - Internet Radio Done Right
12 subscribers
Checked 20m ago
Menambahkan six tahun yang lalu
Konten disediakan oleh Südwestrundfunk. Semua konten podcast termasuk episode, grafik, dan deskripsi podcast diunggah dan disediakan langsung oleh Südwestrundfunk atau mitra platform podcast mereka. Jika Anda yakin seseorang menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda dapat mengikuti proses yang diuraikan di sini https://id.player.fm/legal.
Player FM - Aplikasi Podcast
Offline dengan aplikasi Player FM !
Offline dengan aplikasi Player FM !
Podcast Layak Disimak
DISPONSORI
H
How to Be a Better Human

1 How to communicate better (w/ Charles Duhigg) 36:56
36:56  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai36:56
Menyukai36:56
What makes some people supercommunicators? How can you become one too? This is the central lesson in Charles Duhigg’s bestseller Supercommunicators: How to Unlock the Secret of Communication. Charles and Chris dissect what makes messy conversations so great, how to ask deep questions, and whether women and men communicate differently. They also discuss the different rules for different technologies — from telephones to Facebook to Signal — and how cautious politeness may be the best method to communicate effectively online. Follow Host: Chris Duffy (Instagram: @ chrisiduffy | chrisduffycomedy.com ) Guest: Charles Duhigg (Instagram: @charlesduhigg | LinkedIn: @charlesduhigg | Website: https://charlesduhigg.com/ ) Links Supercommunicators: How to Unlock the Secret Language of Connection The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business Subscribe to TED Instagram: @ted YouTube: @TED TikTok: @tedtoks LinkedIn: @ted-conferences Website: ted.com Podcasts: ted.com/podcasts For the full text transcript, visit go.ted.com/BHTranscripts Interested in learning more about upcoming TED events? Follow these links: TEDNext: ted.com/futureyou Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
SWR2 Kultur Aktuell
Tandai semua (belum/sudah) diputar ...
Manage series 2550181
Konten disediakan oleh Südwestrundfunk. Semua konten podcast termasuk episode, grafik, dan deskripsi podcast diunggah dan disediakan langsung oleh Südwestrundfunk atau mitra platform podcast mereka. Jika Anda yakin seseorang menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda dapat mengikuti proses yang diuraikan di sini https://id.player.fm/legal.
Welche Bücher sind neu, was läuft im Kino, wie sieht die Festivalsaison aus und worüber diskutieren Kulturwelt und Kulturpolitik? Im Podcast SWR Kultur Aktuell widmen wir uns täglich den Nachrichten, mit Hintergründen, Gesprächen, Kritiken und Tipps. Damit Sie nichts Wichtiges mehr verpassen! Zur Sendung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr2-kultur-aktuell/12779998/
…
continue reading
108 episode
Tandai semua (belum/sudah) diputar ...
Manage series 2550181
Konten disediakan oleh Südwestrundfunk. Semua konten podcast termasuk episode, grafik, dan deskripsi podcast diunggah dan disediakan langsung oleh Südwestrundfunk atau mitra platform podcast mereka. Jika Anda yakin seseorang menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda dapat mengikuti proses yang diuraikan di sini https://id.player.fm/legal.
Welche Bücher sind neu, was läuft im Kino, wie sieht die Festivalsaison aus und worüber diskutieren Kulturwelt und Kulturpolitik? Im Podcast SWR Kultur Aktuell widmen wir uns täglich den Nachrichten, mit Hintergründen, Gesprächen, Kritiken und Tipps. Damit Sie nichts Wichtiges mehr verpassen! Zur Sendung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr2-kultur-aktuell/12779998/
…
continue reading
108 episode
كل الحلقات
×S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Der junge oder postmigrantische Blick - Neue Tendenz bei den Filmen des IFFMH 3:40
3:40  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:40
Menyukai3:40
Noch bis zum 16. November läuft das Internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg. Im Mittelpunkt stehen Langfilme von Nachwuchsregisseurinnen und -regisseuren, die um den mit 30.000 Euro dotierten International Newcomer Award konkurrieren. Was insgesamt auffällt ist: Die jungen Filmschaffenden erzählen sehr oft aus der Perspektive von Kindern oder Jugendlichen. Und sie erzählen oft über migrantische oder postmigrantische Erfahrungen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Fotograf Vincent Haiges zeigt das Leben in Krisengebieten – Ausstellung in Worms 3:54
3:54  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:54
Menyukai3:54
Fotografie als Werkzeug der Dokumentation Eine Mutter umarmt ihren aus dem Krieg heimkehrenden Sohn – für dieses Bild aus Äthiopien hat Vincent Haiges 2024 den „World Press Foto Award“ gewonnen. Vincent Haiges bezeichnet sich als Fotograf, der über Konfliktthemen arbeitet. Er hat einen Master in Politikwissenschaft. Die Fotografie ist sein Werkzeug, um Kriege und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Identifikation mit den Menschen vor Ort Dafür kehrt er immer wieder in die gleichen Länder zurück. Dort begleitet er die Menschen vor Ort für längere Zeit, will ihnen so nahe wie möglich kommen. In der Ausstellung findet man keine blutrünstigen Bilder von der Front. Denn solche Fotos wirken eher abschreckend und kontraproduktiv, findet Vincent Haiges. „Natürlich muss man wissen, dass dort Brutalität und Gewalt herrscht. Aber gerade wenn es in die dokumentarische Richtung ist, geht es eigentlich darum, Räume zu schaffen, wo Menschen sich auch ... mit den Menschen dort identifizieren können", erklärt der Fotograf seinen Ansatz. Wichtig ist ihm, „dass man versteht: Das sind genauso Menschen, die sich verlieben, schwanger werden, ihre Träume haben, aber eben im Krieg leben.“ Fotografie kann Kriege nicht beenden In seinem Selbstverständnis als Fotograf ist Vincent Haiges sehr klar. Die Fotografie habe nicht die Aufgabe und nicht die Macht, Kriege zu beenden, sagt er. Wer diesen Anspruch hat, werde schnell desillusioniert. Daher versteht er sich in erster Linie als Berichterstatter, als jemanden, der Informationen zur Verfügung stellt.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Fake News, die die Welt verändern: „Historische Fälschungen“ von Emanuela Lucchetti | Buchkritik 4:09
4:09  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:09
Menyukai4:09
Ist jemals in der Weltgeschichte die Menschheit derart schamlos belogen worden? Waren je zuvor Verschwörungsbehauptungen so erfolgreich wie in diesen Tagen? Haben Staatenlenker früherer Zeiten ebenso wirkungsvoll Fake News verbreitet wie die Trickbetrüger im Kreml und im Weißen Haus? Aber sicher. Wie ein roter Faden durchziehen Fälschungen die Geschichte. In jeder Epoche haben die Gesellschaften sich der jeweils zeitgenössischen Mittel und Technologien bedient, um Desinformation zu erzeugen. Und dies zu vielfältigen und einander komplementären Zwecken – propagandistischen, politischen, militärischen ökonomischen –, um eine alternative und zugleich plausible Realität herzustellen. Quelle: Emanuela Lucchetti – Historische Fälschungen „Historische Fälschungen“ heißt Emanuela Lucchettis schmales Traktat, das nirgends den Anspruch einer umfassenden Darstellung erhebt. Der jungen italienischen Historikerin und Journalistin, Jahrgang 1993, geht es um ein Wirkungsmuster. „In jeder Epoche hat die menschliche Gesellschaft Fake News erzeugt und in Umlauf gebracht, deren Effizienz erst dann offenbar wird, wenn – und unter der Bedingung, dass – sie aufgedeckt werden.“ Dieses Muster macht Lucchetti anschaulich anhand von „vier Fällen, die die Welt verändert haben“. Hat der Kaiser der Kirche wirklich sein halbes Reich geschenkt? Der älteste dieser Fälle ist die vorgebliche Konstantinische Schenkung: Der Vatikan behauptete jahrhundertelang, der römische Kaiser Konstantin I. habe im Jahr 315 zum Dank für eine Wunderheilung durch Papst Silvester I. große Teile des Reichs der Kirche vermacht. Beglaubigen sollte dies eine Urkunde, von der päpstlichen Staatskanzlei im achten Jahrhundert angefertigt und auf das vierte Jahrhundert zurückdatiert. Erst durch die Humanisten der Renaissance wurde sie als Fälschung entlarvt. Lucchetti benennt die historischen Parallelen wie die Unterschiede. Das Mittelalter, erklärt sie mit Umberto Eco, habe Wahrheit nicht so sehr an der Richtigkeit von Fakten festgemacht, sondern vor allem an der Glaubwürdigkeit der Botschaft: Das, was wir heute als Manipulation verstehen, war damals eine gängige Praxis, um das Vertrauen in eine anerkannte Ordnung zu stärken. Heute dagegen wird dieselbe Praxis – mittlerweile hochentwickelt, aber immer noch auf uralten Impulsen basierend – eher dazu verwendet, Misstrauen und Unordnung herzustellen. Quelle: Emanuela Lucchetti – Historische Fälschungen Die große jüdische Weltverschwörung Besonders wirkmächtig waren im zwanzigsten Jahrhundert die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, angeblich Dokumente einer jüdischen Weltverschwörung. Entstanden 1903 im Auftrag der russischen Geheimpolizei, kombinierten sie alte antijüdische Stereotype mit dem neuen Narrativ einer Gruppe jüdischer Strippenzieher und ihrer Strategie zur Erringung der Weltherrschaft. Die Autorin schildert, wie das Machwerk, ursprünglich ein Katalysator für die Pogrome des bröckelnden Zarenreichs, auch im Westen verbreitet und zum Manifest des weltweiten Antisemitismus wurde. Obwohl bereits seit 1921 als Fälschung entlarvt, wirkt sein Gift immer weiter. Die Verschwörungslüge munitionierte nicht nur die deutschen Nazis, sondern wird auch von arabischen Nationalisten und muslimischen Fundamentalisten munter gegen Israel angeführt. Wie man Völker dazu bringt, in den Krieg zu ziehen In abwechslungsreicher Darstellung, die ganz ohne akademischen Jargon auskommt und sich erkennbar an eine junge Leserschaft richtet, behandelt Lucchetti auch zwei weitere propagandistische Fälschungen aus der jüngsten Geschichte, die ihren Ursprung in den USA haben. Der frei erfundene Tonkin-Zwischenfall von 1964 diente der Begründung des Vietnamkriegs, und die Geschichte angeblicher Massenvernichtungswaffen im Irak von 2003 rechtfertigte den Angriff auf das Regime von Saddam Hussein. Solche Dinge haben Folgen. Denn, wie Hannah Arendt sinngemäß schrieb: ein Gemeinwesen, das so lange belogen wird, bis es nicht mehr unterscheiden kann zwischen Wahrheit und Lüge, verliert jegliche Stabilität.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Die Angst ist immer da“ Gespräch mit Salman Rushdie-Übersetzer Bernhard Robben 6:05
6:05  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai6:05
Menyukai6:05
Rushdie musste sich das Erlebte von der Seele schreiben Das Schreiben habe Rushdie geholfen, das Erlebte zu verarbeiten – vorher habe Rushdie keinen Zugang zum Erzählen gefunden, berichtet Robben. „Er musste sich das wirklich von der Seele schreiben. Und danach, hat er erzählt, ist der Erzählraum wieder für ihn geöffnet gewesen.“ Das Attentat auf Rushdie kam keineswegs aus dem Nichts, sagt Robben. Rushdie hatte vor allem mit seinem Roman „Die satanischen Versen“ Islamisten provoziert; die iranische Geistlichkeit verurteilte ihn wegen Gotteslästerung zum Tod und rief zum Mord an ihm auf. Bis heute ist nicht bekannt, wer die deutsche Übersetzung des Romans verfasste. Er selbst sei es nicht gewesen, sagt Robben. Auftritte mit Rushdie trotz Angst Wer sich mit Rushdie zeigt, lebt gefährlich, so schildert es Robben. Bei gemeinsamen Auftritten etwa sei die Angst immer da. Trotzdem sei es ihm wichtig gewesen, weiter an Rushdies Seite zu bleiben: „Es war immer auch der Trotz. Denn trotz dieser Angst wusste ich, ich kann mich denen nicht entziehen. Und ich werde mit ihm auftreten, auch wenn die Angst da ist.“…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Rock'n' Roll-Legende will Neues Ausprobieren: Neil Young wird 80 und geht nich lange nicht in Rente 3:39
3:39  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:39
Menyukai3:39
Neil Young wird 80 Jahre alt. Der Rocker blickt auf eine über 60 Jahre währende Musikerkarriere zurück. Sorgen um das Altern mache er sich dabei aber nicht: „Im Gegenteil: Ich spüre, dass ich noch wachse. Dass ich lerne, Dinge besser hinzubekommen – und leichter damit umgehe, wer ich bin und was ich tue. Außerdem ist es toll, Neues zu erleben. Du musst immer Sachen ausprobieren, die du noch nicht kennst.“ Der gebürtige Kanadier machte schon immer gerne das, was ihm gefiel, und probierte sich auch immer gerne in neuen Stilen aus. Die Bilanz: 49 Studioalben, die sich weltweit mehr als 28 Millionen Mal verkauften. Neben der Musik hört der „Heart of Gold“- Sänger derweil nicht auf, sich auszuprobieren. So trat er etwa als Regisseur, Buchautor, Büffelzüchter und Streaming-Anbieter in Erscheinung. Privat sammelt Young Gitarren, Oldtimer und Modelleisenbahnen. Letzteres geht sogar so weit, dass er sogar im Vorstand des Spielzeugherstellers „Lionel“ sitzt und an der Produktentwicklung beteiligt ist. Er brauche das, um sich zu entspannen, sagte Young einmal.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Der Mann im Bademantel ist zurück - Komiker und Multitalent Olli Dittrich auf Solo-Tour 14:10
14:10  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai14:10
Menyukai14:10
„Dittsche ist immer bei mir, das ist die älteste Figur, die ich habe“, sagt der Komiker im Gespräch mit SWR Kultur. Auch der Bademantel ist immer noch der, den Dittrich bei seinem ersten Bühnenauftritt als „Ditsche“ getragen hat, das war bereits 1991. Von 2004 bis 2021 improvisierte Dittsche zu aktuellen Themen im Fernsehen, ohne Drehbuch, dafür mit viel subversivem Humor. Bei seinen Bühnenauftritte gebe es dagegen schon vorbereitete Geschichten und eine Dramaturgie, aber „ich glaube, ich erzähle keine Geschichte zweimal auf die gleiche Art und Weise“, betont Olli Dittrich. Es gibt immer auch tagesaktuelle Momente. Ein Standardsatz von Dittsche ist dabei: „Och, was wollte ich garnicht erzählen, wo war ich gerade?“ „Das freut die Leute natürlich auch“, so Dittrich, „weil kaum etwas spannender ist, als wenn man dabei ist, wenn etwas entsteht.“ Am 15. November ist Dittsche in der Liederhalle Stuttgart zu erleben.…
1 Mannheim liest ein Buch: „Alles immer wegen damals“ von Paula Irmschler 4:15
4:15  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:15
Menyukai4:15
Ausgesucht wird das jeweilige Buch von einer Jury aus Vertretern verschiedener kultureller Einrichtungen, Schulen, Bibliotheken und der Universität Mannheim. Angeboten werden dazu Lesekreise, Diskussionen, Uni-Seminare und Schreibwerkstätten und Vieles mehr. „Alles immer wegen damals“ ist eine Geschichte über eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung in Ost und West. Der Roman bietet damit viele Anknüpfungspunkte für Diskussionen über verschiedene Familien-Konstellationen, Mütter-Rollen und Lebensentwürfe.…
1 Künstlerduo aus Serbien und Kroatien: „Viele sehen keinen Sinn darin, weiter verfeindet zu sein“ 3:58
3:58  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:58
Menyukai3:58
Ein Faden verbindet zwei Lebensgeschichten Wie gelingt Versöhnung zwischen Menschen, deren Herkunftsländer einst verfeindet waren? Für die Künstlerin Ivana Matić aus Serbien und den Fotografen Danijel Sijakovic aus Kroatien beginnt sie mit einem Faden. In ihrem Mainzer Atelier sitzen beide über einer Stickvorlage, konzentriert, manchmal fluchend wegen eines verlorenen Fadens, und erschaffen gemeinsam Gobelins. Die Bildwirkereien zeigen aktuelle Motive aus ihrer alten Heimat. Was auf den ersten Blick nach traditioneller Handarbeit aussieht, entpuppt sich als stilles Erinnerungsprojekt. Keine Naturidylle, keine lesende Frau, wie man sie von alten Wohnzimmerwänden kennt. Keine Heile-Welt-Ansichten oder Blumenmotive. Stattdessen: ein schlichtes serbisches Wohnhaus, in märchenhaftes Licht getaucht. „Ich habe das aufgenommen, weil es so typisch ist“, erzählt Ivana Matić, „Danijel hat ein ganz ähnliches Motiv und fast dieselbe Stimmung“. Eine Herausforderung, denn ein Gobelin funktioniert wie die Pixel eines Fotos: für jede Farbe müssen sie den Faden wechseln. Flucht, Erinnerung, Sehnsucht Als Danijel drei Jahre alt war, floh er mit seiner Familie aus dem kleinen Ort Bijelo Brdo, heute Kroatien, vor dem Jugoslawienkrieg. Ivana wanderte Jahre später als 20-Jährige aus der serbischen Stadt Śabac aus. Unabhängig voneinander sind sie immer wieder dorthin zurückgekehrt, auf der Suche nach Spuren ihrer Herkunft. Dabei haben sie, ohne es zu wissen, Ähnliches gesehen und fotografiert: Fassaden, Lichtschalter, Tore, Strommasten. „Es sind oft kleine Details – ein Lichtschalter, ein Tor – die man hier so nicht findet“, sagt Danijel Sijakovic. „Man kann es schwer festmachen, aber genau das ist dieses Gefühl von Zugehörigkeit.“ Um ihre Motive als Gobelins sichtbar zu machen, mussten beide zunächst einen Schritt zurücktreten – buchstäblich wie im übertragenen Sinn. Nur aus der Distanz erschließt sich das Bild. Der Krieg ist der unsichtbare Elefant im Raum, eingeschrieben in Material, Blick und Erinnerung. Auf einem der Gobelins ist ein Strommast aus Danijels kroatischem Heimatdorf zu sehen, ein Gewirr aus Kabeln vor blauem Himmel, Sinnbild für die fragile Infrastruktur und für die Nachwirkungen der Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Gegenwart und Verantwortung Für beide ist nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart in ihren Heimatländern sehr präsent. Die politische Lage in Serbien und Kroatien, Nationalismus, Korruption und Pressefreiheit beschäftigen sie. Dass in Serbien seit dem Einsturz des Bahnhofsdaches von Novi Sad 2024, bei dem 16 Menschen starben, jede Woche Tausende gegen die Regierung von Aleksandar Vučić auf die Straße gehen, bewegt die beiden. Auch sie demonstrieren für Neuwahlen, aber von Deutschland aus, wie zum Beispiel in Frankfurt bei einer Sympathie-Kundgebung . Gerade bei Ivana Matić ist der Jugoslawienkrieg immer noch sehr präsent. Ihre Bilder wirken bedrohlich. „Vielleicht merkt man es an meinen Zeichnungen“, sagt sie, „diese sind düster, farblos, schwer. Vielleicht eine direkte Verbindung zu dem, was ich als Mädchen im Bombenkeller erlebt habe.“ Von der Handarbeit zur Versöhnung Um ihre Motive in Gobelins zu verwandeln, haben beide das Sticken von ihren Großmüttern und Tanten gelernt. Doch ihr Projekt ist mehr als Handwerk: Es ist ein Versuch, den Schmerz der Vergangenheit zu verweben und gleichzeitig etwas Neues zu schaffen, etwas Verbindendes. Ihre Zusammenarbeit zeigt, dass es gerade die junge Generation ist, die alte Grenzen hinterfragt. „Es gibt den Versuch, das zu brechen“, sagt Danijel Sijakovic. „Viele junge Leute sehen keinen Sinn mehr darin, weiter verfeindet zu sein.“…
1 Peter Schneider – Die Frau an der Bushaltestelle | Buchkritik 4:09
4:09  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:09
Menyukai4:09
Von einer begehrenswerten Frau, die nichts als gute Gespräche und Freundschaft in Aussicht stellt, sollte ein liebender Mann sich fernhalten. Allerdings muss auch der leidenschaftlich Geliebte mit Schwierigkeiten aller Art rechnen: Wer von der größten Liebe seines Lebens spricht, meint damit eine, die neben den euphorischen Augenblicken auch das größte Unglück und die schlimmsten Verletzungen hervorgebracht hat. Quelle: Peter Schneider – Die Frau an der Bushaltestelle Von so einer schicksalhaften Begegnung handelt Peter Schneiders neuer Roman „Die Frau an der Bushaltestelle“. Es ist die im Westberlin der 1960er Jahre angesiedelte Geschichte des eher unscheinbaren Studenten Nick, der widerstandslos der wunderschönen, alle Männer betörenden Isabel verfällt, die kurz vor dem Mauerbau aus der DDR in den Westen kam. Einer fürs Bett und einer für die Seele Die Geschichte wird – im Abstand von mehr als fünfzig Jahren – aus der Perspektive des liebenden Freundes erzählt, dem damals nur die Rolle des Beobachters und Beraters zukam, oder, wie er das formuliert: Nick war fürs Bett und er für die Seele zuständig. Dieser Ich-Erzähler, als millionenschwerer Erbe eines Textilunternehmens mit Sportwagen und sehr viel Selbstbewusstsein, erinnert sich der Epoche des jugendlichen Aufbegehrens und der beginnenden Studentenrevolte. Es ist die Zeit politischer Leidenschaften und ideologischer Verblendung, die für Peter Schneider zu einem Lebensthema geworden ist. Vielleicht waren diese Monate des Umherschweifens die beste Zeit – dieses Mitschwimmen, Sichbegeistern, und Sich-auch-wieder-Abstoßen von einem Aufbruch, der noch keinen Namen und kein Programm hatte. Wenn es ein Motiv gab, das all diese jungen Leute einte, so war es die Suche nach einer anderen, einer besseren Art zu leben. Quelle: Peter Schneider – Die Frau an der Bushaltestelle Schneiders Erzähler ist aber auch in Sachen Politik mehr Beobachter als Mitspieler. Am Beispiel der beiden so heftig wie unglücklich Verliebten zeigt er, wie das Scheitern der Beziehung zur politischen Radikalisierung führte – jedenfalls auf Seiten Isabels. Anfang der 1970er Jahre gleitet sie in eine linksterroristische Gruppierung ab, ohne dass Nick oder der allzu vernünftige Erzähler sie davon abhalten könnten. Das tragische Ende ist vorgezeichnet. Aus Liebesnot wird Terrorismus Das Private ist politisch, hieß es damals. Bei Peter Schneider wird das verfehlt Politische zur Konsequenz privater Liebesunfähigkeit und persönlicher Verwundungen. Diese eher schlichte These wäre akzeptabler, wenn sie mit etwas weniger Zwangsläufigkeit und Bescheidwissertum vorgetragen würde. Tatsächlich aber ist Schneiders altherrenhaft abgeklärter Erzähler mit der 68er-Epoche längst fertig; da gibt es keine Überraschungen mehr und nichts in seinen Erinnerungen, was man nicht schon wüsste – vom berechtigten Zorn auf das Schweigen der Väter über ihre NS-Vergangenheit bis hin zur eskapistischen K-Grüppchenhaftigkeit all der ideologischen Spezial-Rechthaber am Ende der Epoche. Ein wenig mehr Verunsicherung hätte dem zurückblickenden Erzähler da gut gestanden. Stattdessen füllt er all die zahlreichen Leerstellen der Liebesgeschichte mit seiner literarischen Fiktion, ohne auch nur ansatzweise zu zögern, wenn er intime Streits oder Bettszenen von Nick und Isabel ausmalt, von denen er doch gar nichts wissen kann. Historische Fehler Diese erzählerische und historisch nachgetragene Selbstgewissheit führt zu einer konventionellen, geradezu papierenen Sprache. Sie wird umso mehr zur Schwäche des Buches, als Schneider ein paar grobe historische Fehler unterlaufen: Die Defa-Verfilmung von „Jakob der Lügner“ aus dem Jahr 1974 kann von Isabel unmöglich schon 1965 gesehen worden sein. Und wenn für 1970 auf die Militärdiktatur in Chile verwiesen wird, dann geraten auch da die Zeiten durcheinander. Das dürfte einem, der alles überblickt und längst eingeordnet hat, wahrlich nicht passieren.…
1 „Der Affenkönig“ von Milo Manara – Der etwas andere Superheld 6:03
6:03  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai6:03
Menyukai6:03
Der andere Milo Manara Bekannt wurde Milo Manara mit seinem voyeuristischen Comic-Blick und stereotypen Frauenfiguren, die auf Knopfdruck das machen, was Männer oder männliche Zeichner wollen. In einem Frühwerk aus den 1970er Jahre zeichnete Manara den alten chinesischen Mythos vom „Affenkönig“ neu und schuf dabei einen etwas anderen Superhelden, vom dem die Superhelden-Gegenwart durchaus etwas lernen könnte. Superhelden überall “We don´t need another hero” – die Songzeile von Tina Turner scheint in der popkulturellen Gegenwart nicht mehr zu passen, die Sehnsucht nach Helden bleibt weiter aktuell. Im Kino und im Comic läuft die Superhelden-Produktionsmaschine weiter wie geölt und das Genre beantwortet die Ängste der Gegenwart immer und immer wieder mit der Hoffnung, dass es doch jemanden geben muss, der die Dinge noch im Griff hat. Was dabei auffällt, ist, wie ernst die Popkultur die Superhelden-Verehrung regelmäßig nimmt. Selbstironische Helden gab und gibt es manchmal, oft regiert aber der heroische Ernst. Ein Blick zurück: Der Affenkönig von 1976 Vielleicht sollte man zum Thema Superhelden einen alten Comic von Milo Manara von 1976 gegenlesen, der nun wieder aufgelegt wurde. „Der Affenkönig“ ist zunächst einmal eine Figur des chinesischen Mythos, es gibt diese mythische Märchenfigur aber auch in anderen asiatischen Literaturtraditionen. Der Affenkönig ist von seiner Gestalt her ein sehr menschlicher Affe, geschlüpft aus einem Ei, nachdem der Wind die Erde befruchtet hat, so der Mythos. Zwischen Himmel und Erde Er ist also eine Figur zwischen Himmel und Erde. Mit der europäischen Brille würde man vielleicht sagen: Er ist eine Art Halbgott, der sowohl die Menschenwelt als auch die Welt der Götter immer wieder herausfordert. Denn der Affenkönig ist ein Anarchist, ein Freigeist, ein Rebell, aber auch ein Quatschmacher und ein Clown. Ihn hat Milo Manara zu einer Art Hippie-Gott gemacht: Der Affenkönig gründet in einem Land hinter einem Wasserfall – im Land der Blumen und der Früchte – eine Kommune. Eine Kommune aus jungen Frauen und Männern. Die laufen splitternackt umher, leben von Luft, Liebe und Musik und feiern mit ihrem Affenkönig eine nie endende Party. Rebellion gegen die Götter Doch auch gegen dieses frivol-friedliche Leben rebelliert der Affenkönig. Das Paradies wird im zu viel. Er möchte mehr werden, ein richtiger Gott mit besonderen Kräften, der vor allem unsterblich ist. Dann zieht er los, findet einen Meister, lernt und entwickelt magische Kräfte, die Fähigkeit, zu fliegen und seine Gestalt zu verwandeln. Doch damit gehen die Schwierigkeiten los, denn der Affenkönig fordert die mächtigsten Götter der chinesischen Sagenwelt heraus, vor allem den mächtigen Jadekönig. Der Affenkönig ist ein Getriebener in ruheloser Bewegung, der den Kampf, das Geheimnis, das Abenteuer magnetisch anzieht. Eine Äquivalenz zu modernen Superhelden, deren Eigenschaften oder Lebenstraumata immer neue Konflikte schaffen. Beim Affenkönig ist es die Rebellion aus Prinzip, die Infragestellung aller Sicherheiten. Und in der Interpretation von Milo Manara geht er sogar dem großen Gott Buddha auf die Nerven – und Buddha, der in diesem Comic gar nicht so weise und großzügig, sondern eigentlich ziemlich brutal ist, ist dermaßen herausgefordert, dass er den Affenkönig unter einem Berg mit fünf Fingern begräbt. Begraben unter dem Berg der Macht Das ist auch das Schlussbild von Manara: Dieser Berg besteht aus vielen kleinen Figuren und Schriftzügen. Von der autoritären Gottheit begraben sind unter anderem der erste Premierminister des unabhängigen Kongo, der ermordete Patrice Lumumba. Und begraben ist auch der historische Kompromiss zwischen Kommunisten und Christdemokratien in Italien, der zuerst von Rechtsextremisten und dann von Linksterroristen torpediert und im Ergebnis verhindert wurde. Mit dem freiheitsliebenden Affenkönig werden also symbolisch progressive politische Hoffnungen der 70er Jahre am Ende begraben. Durchaus eine bittere politische Wendung, nach einem zeichnerischen Feuerwerk voll von Leichtsinn und Überschwang. Zwischen Moebius und Manara Auffällig ist, wie sehr sich Manara in diesem Frühwerk am Strich von Moebius orientiert hat, ohne dessen figurale Prägnanz und räumliche Genialität annähernd zu erreichen. Aber anders als bei seinen späteren sexistischen Stereotypen gelingt es Manara beim Affenkönig, dass realistische Gewalt und realistischer Sex kein illustrativer Selbstzweck sind. Ein witziger Wechsel der graphischen Stimmungen dominiert und bebildert den anarchistischen Drang des Affenkönigs, frei zu sein und einfach alles anders zu machen als alle Gottheiten vor ihm. „Ich war hier“ – Ironie als Widerstand Es gibt eine kleine Szene, in der sich der Affenkönig mit dem großen Buddha anlegt. Er macht einen riesigen Sprung und landet in einer Wüstenlandschaft. Aber die ist eigentlich die riesige Handfläche von Buddha. Doch der Affenkönig merkt das nicht und was macht er? Er schreibt mit einem Stock erst einmal den denkwürdigen Satz in den Sand: „Ich war hier“. Und dann pinkelt er gleich daneben und bemerkt bevor er weiterfliegt: „Ein würdiges Zeichen meiner Anwesenheit.“ Was unsere Helden lernen könnten Die ironische-selbstironische Attitüde des Affenkönigs – wäre es nicht schön, wenn sie unsere Superheldengegenwart etwas herausfordern könnte? Gewissermaßen als ideologiekritisches Gegenbild zu den Bildern, in denen das Leben als ewiger Kampf inszeniert wird und nur die Perfektion von Helden mit Superkräften bestehen kann. Diese ernste, oft hypermoralische und sehr kapitalistische Superhelden-Weltsicht würde eine Portion 70er-Jahre-Anarchie gut vertragen. Also ein bisschen von dem Freiheitsdrang und der Aufmüpfigkeit des Affenkönigs von Milo Manara. Der springt wild und frei hin und her, zwischen Ironie und existentiellem Ernst. Und stellt ganz beiläufig große Fragen – nach der persönlichen Freiheit und danach, wie sie stets an die Grenzen starrer Machtverhältnisse stößt.…
1 „Yes“ von Nadav Lapid – Bitterböses Porträt der militarisierten Gesellschaft Israels 4:39
4:39  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:39
Menyukai4:39
Entertainer der Upper Class in Tel Aviv Y. und seine Partnerin Jasmine sind Entertainer. Bei ausschweifenden Partys der Upper Class in Tel Aviv pushen sie die Stimmung mit schrillen Performances übers Limit. Wenn es sein muss, erfüllen sie auch sexuelle Gefallen. Dabei träumen sie eigentlich davon, als ernsthafte Künstler wahrgenommen zu werden. Als Y. im Zuge des Gaza-Kriegs von einem reichen Russen den Auftrag bekommt, eine neue Hymne für Israel zu komponieren, scheint das Ende ihres prekären Lebens in Reichweite. Verlockung des russischen Oligarchen Der martialische Text, den Y. vertonen soll, feiert die vollständige Zerstörung Gazas. Y. kümmert das wenig. Zu verlockend ist das große Geld. Und von moralischen Prinzipien hat er sich sowieso schon lange verabschiedet. Die wichtigste Botschaft, die er seinem kleinen Sohn mitgibt: Es gibt nur zwei Wörter auf der Welt, „Ja“ und „Nein“. Wie der Filmtitel „Yes“ andeutet, hat er sich entschieden, ein Ja-Sager zu werden, weil es das Leben so viel einfacher macht. Was mit einem „Ja“ zum angenehmen Leben in Tel Aviv beginnt, endet mit einem „Ja“ zur Zerstörung Gazas. Diese Entwicklung führt der israelische Regisseur Nadav Lapid am Beispiel seines passiven Protagonisten vor. Regisseur Nadav Lapid klagt an Sein Film ist laut, wütend, widerständig, schräg, überdreht. In grellen Farben zeichnet er das Bild einer militarisierten Gesellschaft, die unempfänglich geworden ist für das Leid, das der Krieg verursacht. Hier haben Dialog, Zweifel und Kritik seiner Ansicht nach kaum noch Platz. Lapid, der selbst seit Jahren in Frankreich lebt, geht hart ins Gericht mit seinen Landsleuten. Dem Trauma des 7. Oktober gibt er in einer starken Szene zwar auch Raum. Doch sein Fokus liegt auf der israelischen Reaktion auf den Terrorangriff. Dass der Gaza-Krieg von einem Großteil der Gesellschaft unterstützt wurde, empfindet er als moralischen Abgrund. Blutrünstige Hymne ist real „Yes“ ist eine hochtourige Satire, und doch ist vieles, was einem überzeichnet vorkommt, real. So handelt es sich bei der blutrünstigen Hymne des Films um den „Friendship Song“ von 2023, herausgegeben von der nationalistischen Organisation „The Civil Front“. Nicht einmal, dass dieser Song zur Unterstützung der Armee von einem Kinderchor dargeboten wird, ist erfunden. Schwere Themen in leichter Verpackung So schwer die Themen sind, die Lapid verhandelt, so leicht ist überraschenderweise die Form, die er dafür wählt. In der ersten Hälfte fühlt sich „Yes“ mit den rasanten Musik- und Tanzeinlagen fast wie ein Musical an. Und vielleicht hat Lapid ja doch noch einen Funken Hoffnung, wenn schon nicht für die Gesellschaft als Ganzes, so doch für den Einzelnen. Am Ende entscheidet sich Y. jedenfalls für die Liebe und verlässt Israel zusammen mit Jasmine und Noah. Ein kleiner Lichtblick auf der Suche nach Erlösung in einer Welt, die davon gerade wenig anzubieten hat. Trailer „Yes“ – ab 13.11. im Kino…
1 So zeichnete Grafikdesigner Heinz Edelmann den Beatles-Film „Yellow Submarine” – Ausstellung in Backnang 3:41
3:41  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:41
Menyukai3:41
Genervte Auftraggeber von Heinz Edelmann: die Beatles Im Frühsommer 1967 wurde der Düsseldorfer Grafiker Heinz Edelmann von einem neuen Kunden nach London gerufen. Es ging um einen Film. Vor Ort stellte sich heraus, dass die potentiellen Auftraggeber eher genervt waren. Sie mussten einen Vertrag erfüllen. Dabei passten Filme eigentlich nicht so ganz in ihr Metier. Es waren - die Beatles. „Die Beatles wollten gar nichts mit diesem Film zu tun haben, die waren es satt, erzählt Valentine Edelmann, die Tochter des Grafikers. „Die wollten nur zu ihrem Maharishi und in Ruhe gelassen werden. Und die dachten, wie kommen wir jetzt weg von diesem Film?” Und doch war ihr Vater Heinz Edelmann bei den lustlosen Beatles in London der passende Profi für eine Sorte Film, die ohne Protagonisten vor der Kamera auskommt: Zeichentrick. „Yellow Submarine“ passte perfekt in die 60er-Jahre Heinz Edelmann kreierte den surreal überdrehten, poppig bunten Look von „Yellow Submarine“, perfekt für den psychedelischen Zeitgeist der späten 1960er-Jahre. „Yellow Submarine” war der erste abendfüllende Trickfilm für Erwachsene überhaupt, und er war ein Erfolg an den Kinokassen. Das allerdings nur wegen der Beatles. Als sich Heinz Edelmann und andere Grafik-Profis an Folgeprojekten versuchten, erlebten sie Flops. „Er ist zurück nach Deutschland und hat wieder Buchumschläge und Plakate gemacht, und wollte auch von diesem ganzen Stil weg. Er ist nach Hause gekommen und hat gesagt: So, das war jetzt genug Flower Power für ein Leben“, schildert Valentine Edelmann. Ikonische Edelmann-Reihe: „Der Fantastische Film“ im ZDF Kuratorin Simone Scholten deutet in der Ausstellung auf gruselige Köpfe, die sich in Monster, Roboter oder Raketen verwandeln, Edelmann-Zeichnungen aus dem ikonischen Trailer der ZDF-Reihe „Der Fantastische Film“. Diese „Mischung aus Science-Fiction, Horror und auch Trash-Film“ werde im Filmtrailer sehr schön zusammengeführt. Der schwarze Humor von Heinz Edelmann blitzt auf vielen Blättern durch. Er macht sich lustig über Beuys, den Panzerkreuzer Potemkin, Zeitungsschlagzeilen und Literaturkritik. Souverän schwimmt er zugleich mit im medialen Haifischbecken. Das liegt vor allem an der grandiosen Qualität seiner Handzeichnungen. Jeder Strich sitzt. Heinz Edelmann wollte mehr sein als ein Illustrator Valentine Edelmann warnt jedoch: „Er wäre sehr beleidigt gewesen, wenn man ihn Illustrator geschimpft hätte. Er hat sich als Grafikdesigner gesehen und hat an die 2.000 Buchumschläge für Klett gemacht. Typografie war seine große Liebe. Konzept und das Bild und die Typo, also das ganze Paket.“ Diese Komplexität ist am besten zu erkennen bei Edelmanns Buchumschlägen für literarische Reihen. Der Vielleser arbeitete für Luchterhand, Hanser, Fische und Klett-Cotta. Mit dem Verleger Michael Klett verband ihn eine enge Freundschaft. Edelmann wohnte jahrelang gleich am Verlagshaus im Stuttgarter Westen. Er designte die Cover für tausende Bücher, darunter auch Mega-Seller wie „Herr der Ringe“. Gute Grafik braucht gute Auftraggeber Doch solche Einträge in die Geschichtsbücher der Populärkultur brauchen günstige Rahmenbedingungen. Die allerdings gebe es heute kaum noch, sagt Valentine Edelmann. „Mein Vater hat im Grunde in seinem ganzen Leben nur vier Kunden gehabt“, sagt Edelmann. Kaum ein Grafiker erlebe heute ein derart lange währendes Vertrauen. „Gute Grafik braucht auch gute Auftraggeber, die daran glauben.“…
1 Die rechtsalternative Buchmesse „Seitenwechsel“ – Viele Besucher aus dem bürgerlichen Spektrum 6:15
6:15  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai6:15
Menyukai6:15
Treffen von AfD-Mitgliedern und der gesamten rechten Publizistik In Halle hätten sich am Wochenende organisierte Neonazis aus Sachsen und Dortmund, zahlreiche AfD-Mitglieder und Abgeordnete und die gesamte rechte Publizistik getroffen, sagte der Investigativjournalist Olaf Sundermeyer in SWR Kultur. Das Bemerkenswerteste sei jedoch gewesen, dass die große Zahl der Besucher Menschen aus dem bürgerlichen Spektrum waren. Auf der Messe habe man eine „Verbindung zwischen neurechter Publizistik und Menschen, die nicht mehr einverstanden sind mit den demokratischen Verhältnissen hier in Deutschland“ beobachten können, so Sundermeyer. Vermutlich wird der Zuspruch im kommenden Jahr noch größer sein Genau die, die dort gewesen sind, wären im Anschluss nach Hause gegangen und hätten diesen Geist weitergetragen: „Sie leben diese Gegenkultur ganz offensiv, nicht in versteckten Internetforen, sondern auch in der großen Publizistik, die ja mittlerweile auch auf der Bestsellerliste Einzug gehalten hat.“ Weiter sagte Sundermeyer: „Wir haben im Osten mittlerweile einen Aggregatzustand, wo der Rechtsextremismus so weit normalisiert ist, dass man aktiv nicht mehr richtig dagegen vorgehen kann.“ Er rechne damit, so die Prognose des Journalisten, dass die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ im kommenden Jahr noch größeren Zuspruch finden werde. Dadurch wachse der „kulturelle Resonanzboden“ der AfD weiter, und das in einem Bundesland, in dem im kommenden Jahr Landtagswahlen stattfinden.…
1 Fest der Hörspiele - eine Bilanz der ARD Hörspieltage 2025 in Karlsruhe 3:51
3:51  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:51
Menyukai3:51
Die ARD Hörspieltage gelten als das bedeutendste Festival dieser Art im deutschsprachigen Raum. Vier Tage lang gab es im ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) Karlsruhe Premieren und Live-Hörspiele, Konzerte, Performances und Gespräche mit Hörspielmacherinnen und -machern. Im Mittelpunkt standen neun Neuproduktionen der ARD, sowie von Deutschlandfunk, dem Österreichischen und dem Schweizer Rundfunk. Darunter Romanadaptionen, Krimis, Mystery und Science Fiction - der thematische Schwerpunkt der diesjährigen ARD-Hörspieltage, der beim Publikum gut ankam.…
1 Unbekannte Marilyn – Sam Shaws Fotos zeigen die Monroe in einem neuen Licht 4:09
4:09  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:09
Menyukai4:09
Der in New York geborene Sam Shaw gehört zu den renommiertesten Porträtfotografen des 20. Jahrhunderts. Bei wichtigen Hollywood- Produktionen schoss er zudem die Film-Stills, also die Fotos während der Drehs am Set. Shaw war mit Marylin Monroe eng befreundet, schon zuzeiten, als sie noch ein Starlett war. Marilyns Wirbelrock Billy Wilders Film „Das verflixte 7. Jahr“ hat vor allem mit einer Szene der Monroe zu Starruhm verholfen: Ihr schneeweißer Rock wurde durch die Abluft eines U-Bahn-Schachts aufgewirbelt. Die Fotos kennt man – aber beileibe nicht alle. Denn Sam Shaw schoss die Film-Stills und all seine Fotos sind im Buch „Dear Marylin“ zu sehen – einschließlich des Mannes, der die Windmaschine unter dem Gitterrost betätigte. Du hast es geschafft. Nicht, dass ich Harper’s Bazaar und Vogue für Gott den Allmächtigen halte – aber es gibt Parallelen. Quelle: Sam Shaw – Dear Marilyn Sam Shaws Marilyn-Fotos – im Rampenlicht und ganz privat Ab den frühen 1950er Jahren war die Monroe ein Superstar. Sie hatte es auf die Titelblätter der führenden Modemagazine geschafft – so wie es Sam Shaw in seinem Brief an Marilyn beschreibt. Diese Korrespondenz ist auch Teil des Buchs. Shaw verstarb 1999, aber seine Familie hat die Briefe und bislang weitgehend unbekanntes Fotomaterial erst vor kurzem veröffentlicht. Man sieht die Monroe im Negligé beim Telefonieren, beim Erlernen des Klavierspielens, Marilyn stets lächelnd mit Reportern oder mit Hollywood-Produzenten, dann wieder privat beim Bootsrudern oder unerkannt an einer Burgerbude. Eine besondere Sequenz stellt Marilyn am Schminktisch dar – ein voll konzentrierter Profi. Shaw inszenierte aber auch Fotoszenen: In einer setzt sich die Monroe im Central Park neben ein junges Paar auf die Bank und tut so, als würde sie intensiv Zeitung lesen. Sam Shaws Fotografien faszinieren nicht nur durch den steten Wechsel von Aufnahmen der Monroe im Rampenlicht und solchen abseits in privater Umgebung, sondern auch dadurch, dass Shaw sowohl mit Farb- als auch Schwarz/Weiß-Material arbeitet. Das ergibt ganz unterschiedliche Facetten der Diva. Marilyn – Kunst, Literatur, Religion Shaw räumt aber auch mit dem Blondinen-Image der Monroe auf. Sie interessierte sich für moderne Kunst – und Shaw half ihr dabei. Wie gehen wir Deine Kunstsammlung an – gib mir ein Budget und ob Du Gemälde willst oder Zeichnungen – oder Skulpturen. Ich denke, Du solltest bescheiden anfangen, mit Zeichnungen oder Aquarellen und kleinen Ölbildern – dann sehen wir, wie sie auf Dich wirken. Quelle: Sam Shaw – Dear Marilyn Sam Shaw stellt auch einen Aspekt von Marilyn Monroe heraus, vom dem wohl nur wenige wissen, dass er sie intensiv beschäftigt hat. Sie interessierte sich ein Leben lang für Religion. Sie war auf der Suche nach Gott, nach Wissen. Als sie Arthur Miller heiratete, widmete sie sich dem Studium und der Akzeptanz des Judentums. Quelle: Sam Shaw – Dear Marilyn Im Juni 1956 heirateten Marilyn Monroe und Arthur Miller, der vor allem als Dramatiker Bekanntheit erlangt hatte. Er schrieb auch das Drehbuch zu „Misfits – nicht gesellschaftsfähig“ – Marilyns letzter Film 1961. Die Ehe ging in die Brüche, doch Sam Shaw hat eine atemberaubende Fotoserie der beiden festgehalten. Marilyn und Miller fahren in seinem Cabriolet Ford Thunderbird durch New York. Er am Steuer, sie an seine Schulter gelehnt, sie lächelnd und den Leuten zuwinkend, er ganz konzentriert. Die Fotos wirken wie Standfotos zu einem Film – nur dass dieser Film kein Happy End hat. Sam Shaws Buch „Dear Marilyn” ist auch für eingefleischte Monroe-Fans eine klare Bereicherung. Für weniger Kundige ist die Publikation eine ideale Einstiegsdroge. Nicht nur mit Fotos, sondern auch in Worten hat Sam Shaw Marilyns Aura auf den Punkt gebracht She was love / she was loved / and she loved… you. Quelle: Sam Shaw – Dear Marilyn…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Zwei Welten prallen aufeinander - Tiere und Menschen. Die schlaue Füchsin 3:39
3:39  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:39
Menyukai3:39
Man kennt die Oper als „Das schlaue Füchslein“. Doch nicht ganz zu Unrecht vermeidet die Staatsoper in Stuttgart Verniedlichung in Leoš Janáčeks Musiktheater über das Wechselverhältnis von Tier und Mensch, von zivilisatorischem Zwang und natürlicher Freiheit. Sie betitelt die Oper in genauerer Übersetzung als „Die schlaue Füchsin“. Es ist die dritte Produktion von Regisseur Stephan Kimmig an der Staatsoper Stuttgart und als Dirigentin debütiert Ariane Matiakh am Pult des Staatsorchesters. Keine Tierfabel: Wechselverhältnis von Natur und Mensch Der Komponist Leoš Janáček war ein Zeitgenosse Franz Kafkas. Im Werk des Schriftstellers taucht immer wieder etwas auf, von dem die Oper „Die schlaue Füchsin“ eigentlich handelt: das Tierwerden. An der Staatsoper Stuttgart hat Regisseur Stephan Kimmig das vollkommen richtig gesehen: Diese Oper ist keine Tierfabel, sondern das auskomponierte Wechselverhältnis von Tier und Mensch, Mensch und Natur, das Tierische im Menschen und das Menschliche im Tier. Keine unkomplizierte Beziehung, sondern eine auf Leben und Tod. Und letztlich auch eine des Begehrens und der Zerstörung. Im Hintergrund der Bühne von Katja Haß ist die getrennte Natur abgestorbener Bäume zu sehen, eine Wüstenei, aus der fremdartige Wesen mit Leuchtaugen herüberblicken. Der Raum selbst ein Fuchsbau mit Löchern zu Tunneleingängen, den man sich gemütlich machen kann. Es geht ums Domestizieren. Der Förster bringt die junge Füchsin in den Bau und sie verbreitet die Anarchie des Undomestizierten. Die Hennen als Haussklavinnen hetzt sie vergeblich gegen den Machogockel auf und reist den Unemanzipierten ihre falschen Federn herunter. Begehren einer anarchischen Weiblichkeit Die Menschen, der Förster, der Lehrer und der Pfarrer sehnen sich nach dem Undomestizierten, das sich ihnen im Natürlichen offenbart. Ihr Begehren projizieren sie auf ein anarchisch Weibliches, das sich in der nicht erreichbaren, umherziehenden Terynka verkörpert. Am Ende bekommt sie der Brutalste von ihnen ab, der Wilderer Harasta. Er schießt die Füchsin tot. Einen Muff will er für Terynka haben, um sich damit weibliche Freiheit gefügig zu machen. Die Vergänglichkeit beklagt der Förster, der sich der Natur anverwandeln will und schon die Hose des Fuchses trägt. Im Triumph der sich erneuernden Natur, wo der Frosch des Anfangs in seinem Enkel wiederkehrt, steht auch die tote Füchsin wieder auf, während der Förster wie ein Gekreuzigter an der Wand des Fuchsbaus niedersinkt. Wilder Sex auf heimeligem Sofa Das sind alles wunderbar gestaltete Szenarien durchlässiger Grenzen zwischen dem Kreatürlichen und dem Zivilisatorischen als existenzieller, überzeitlicher Wahrheit. Selbst Fuchs und Füchsin können sich dem nicht entziehen, wenn sie auf dem ganz heimelig bereiteten Sofa den wildesten Sex haben, aus dem gleich eine ganze Fuchsschar hervorspringt. Und das Ganze ist dazu noch stylisch in den fantastischen Kostümen von Anja Rabes, die das Tierische ins modische Raffinement verwandeln. Da verkörpert sich die Sehnsucht nach dem undomestiziert Ursprünglichen, das zugleich unerreichbar bleibt. Wir können uns nur kostümieren. Triumph des Staatsorchesters und hymnische Klänge Ganz erreichbar sind aber Janáčeks hymnische Naturklänge. Die Aufführung wartet mit einem fabelhaften und homogenen Ensemble auf. Claudia Muschio spielt und singt glasklar mit lustvoller Anarchie die Füchsin Schlaukopf. Ihre füchsische Partnerin ist Ida Ränzlöv, die dunkel timbrierte Verführung des Naturkinds. Pawel Konik ist ein Förster zwischen Gewalt, Begehren und kosmischer Melancholie, der mit träumerischem Bariton auch den gibt, bei dem man nicht weiß, ist’s Traum, ist’s Wirklichkeit. Der Lehrer von Moritz Kallenberg ist in seiner unbeholfenen Sehnsucht nach Terynka ungemein berührend. Und schließlich ist es der Triumph des Staatsorchesters, das mit Hingabe ungemein schön spielend wie lange nicht mehr der Dirigentin Ariane Matiakh folgt, die sich Janáčeks Partitur zwischen gespielter Einfachheit und Komplexität perfekt einverleibt hat. Ein zu Recht umjubelter Abend an der Staatsoper Stuttgart.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 König Lear und Trump: Schillerrede von Eva Illouz über Männer mit großem Ego 3:24
3:24  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:24
Menyukai3:24
„Erschütternde“ Ausladung in Rotterdam Jedes Jahr wird im Deutschen Literaturarchiv in Marbach die Schillerrede gehalten. Anlass ist der Geburtstag des Dichters am 10. November. Und so war diesmal die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz angereist, die gerade erst unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten war. Die Universität Rotterdam hatte Illouz erst ein-, dann wieder ausgeladen. Weil sie auch an der Hebräischen Universität von Jerusalem unterrichte, fühle man sich „unbehaglich“, so die Begründung. Vor diesem Hintergrund fiel die Begrüßung in Marbach betont herzlich aus. Arne Braun, Baden-Württembergs Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, nannte die Rotterdamer Ausladung „erschütternd“. Hochschulen sollten ein Ort des offenen Dialogs sein. Scharfe Kritik an US-Präsident Trump Ein sehr offenes Wort fand dann Eva Illouz in ihrer Schillerrede. In ihrem Vortrag, der sich mit Shakespeare und den Kategorien von Moral und Chaos beschäftigte, übte sie scharfe Kritik an US-Präsident Trump, der sich selbst nicht in Frage stelle und mit seinem Regierungsstil einen antidemokratischen Autoritarismus fördere. Fast eine Stunde lang vertiefte sich Eva Illouz in einer detaillierten Analyse von Shakespeares King Lear, um dann das Publikum mit ihren Feststellungen aufzurütteln: Trump sei eine neue Art faschistischer Führer, der keine klare und starre Ideologie vertrete, sondern im Gegenteil: er stifte Verwirrung und zwar eine Verwirrung, die im vorherigen technischen Zeitalter nicht möglich gewesen sei. So nüchtern diese These plötzlich im Raum stand, unvorbereitet kam sie nicht. Nicht umsonst hatte Eva Illouz Shakespeare in den Mittelpunkt Ihrer Rede gestellt. Schließlich lese man Texte, um sich auf indirekte Weise mit den Unsicherheiten, dem Leid und den Torheiten des menschlichen Lebens auseinanderzusetzen. König Lears grundlegender Fehler Und so hatte die Soziologin in dem Drama König Lear noch einmal sehr genau die Stelle studiert, in der die Tochter dem König, ihrem Vater, ihre uneingeschränkte Liebe versichern soll. Was sie nicht tut: sie weigert sich, den Vater mit falschen Schmeicheleien zu überschütten. Die Folge: sie wird enterbt und verstoßen. Das sei König Lears grundlegender Fehler, sagte Eva Illouz. Er wollte, dass Cordelia ihn hundertprozentig liebt. Andernfalls würde sie zu seiner Feindin werden. Trumps politisches Verhalten steht, so glaube ich, in direktem Zusammenhang mit seinem Verhältnis zu sich selbst und der Tatsache, dass sein Selbst Ausgangs- und Endpunkt seiner Entscheidungen ist. Die Wahrnehmung von Illoyalität, die Forderung, dass das Gesetz seinen Launen und Feindseligkeiten gehorchen müsse, dass Armee und Polizei als Privatarmee ihm persönlich dienen sollten, entspringt direkt seinem Gefühl, dass sein Selbst nicht in Frage gestellt werden kann. Quelle: Eva Illouz King Lear und Donald Trump – zwei Männer also mit großem Ego, das keinen Widerspruch duldet. Und was in den Augen von Eva Illouz womöglich noch schwerer wiegt: das ist nicht die Missachtung, sondern die Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit und gegenüber den Menschen. In einem Regime, das sich selbst widerspreche, könne man wirklich nicht wissen, für welche Ideen Trump eigentlich stehe. Das führe zu moralischem Chaos. Vor diesem Hintergrund spielen die sozialen Medien nach Ansicht der Soziologin eine fatale Rolle. Soziale Medien sind riesige Technologien der Selbstdarstellung, in denen die Subjekte die Wahrheit über sich selbst verbreiten und mit ihren Followern und „Likes“ prahlen. Was König Lear und Trump wollen, sind Follower. Doch die einzige Funktion von Followern besteht darin, zu bekräftigen und zu bestätigen, wer ich zu sein behaupte. Quelle: Eva Illouz Cordelia, die Königstochter, war keine Followerin, stellte Eva Illouz in ihrer Rede klar. Sie stehe für den mühseligen Dialog über Realität und Selbstreflexion. Etwas, was nach Beobachtung der Soziologin, in den Sozialen Medien, keinen Platz hat. Und so lautet das ernüchternde Fazit: Soziale Medien dienen dazu in der Öffentlichkeit Schmeicheleien zu inszenieren und letztendlich Sinnlosigkeit zu erzeugen: Worte verlieren nicht nur ihre Bedeutung. Es spielt auch keine Rolle mehr, dass sie keine Bedeutung mehr haben. Quelle: Eva Illouz…
S
SWR2 Kultur Aktuell
Gleich auf den ersten Seiten gibt es eine kleine Episode, die den Zauber dieses Buches zusammenfasst – und dabei ist sie eigentlich nicht wirklich zauberhaft. Natascha Wodin wacht morgens auf und entdeckt auf ihrem Kopfkissen ein kleines, rotes Muster. Es hat die Form einer geöffneten Rosenblüte. Wie hübsch! Die blutige Rose als Metapher Ich fragte mich, ob es sich um eine filigrane Stickerei handelte, die ich bisher nicht bemerkt hatte, aber ich konnte keine Erhebungen ertasten. War die kleine Rose kunstfertig in den Stoff hineingewebt? Es dauerte eine Weile, bis ich begriff. Gestern war ich beim Zahnarzt und hatte nach der Parodontosebehandlung meiner letzten fünf eigenen Zähne nachts aus dem Mund geblutet. Quelle: Natascha Wodin – Die späten Tage Eine Rose aus Blut – Romantik und Schmerz nur zwei Sätze entfernt – typisch Natascha Wodin ist das. Die „blutige Rose“ ist mehr als ein alltägliches Detail, sie fasst die besondere Atmosphäre des Buches zusammen: Zärtlichkeit und Leidenschaft mit einem tiefen Bewusstsein für körperlichen und seelischen Schmerz. Liebe im Alter Eine passende Metapher für die Liebe, um die es hier geht, eine späte Liebe im Alter, die „späten Tage“ eben. Die verbringt Natascha Wodin mit ihrem Freund Friedrich. Seit sechs Jahren sind die beiden ein Paar. Es gab Zeiten, da nannte er mich seine Königin, seine Heilige, seine Jeanne d’Arc. Jetzt liegt er nachts mit seinem Tod im Bett. Mit dem zerzausten Rest seiner silbernen Haare sitzt er im Sessel neben mir und lächelt verloren oder starrt ins Leere. Ein immer noch schöner alter Mann, sehr schmal und zart, mit etwas vogelhaften, wie mit einem feinen Bleistift gezeichneten Zügen. Quelle: Natascha Wodin – Die späten Tage Herausforderungen einer späten Beziehung Die Beziehung hatte leidenschaftliche Momente, Romantik, Sex, vor allem der Anfang war stürmisch. Aber dann kam das Ringen mit Schwächen und Fehlern des Anderen, die Erkenntnis, dass die beiden in vielen Dingen sehr verschieden sind – und sich trotzdem viel zu geben haben. So weit, so normal, Beziehungsarbeit braucht es auch im Alter – aber dann sind da noch die körperlichen Probleme: Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich alte Menschen in meinen jungen Jahren wahrgenommen habe. Ich fühlte etwas zwischen Grauen, Mitleid, Verständnislosigkeit und Aversion bei ihrem Anblick, und ich hielt es für ausgeschlossen, dass ich irgendwann genauso werden würde, wie sie. Quelle: Natascha Wodin – Die späten Tage Der Alltag wird beschwerlich Und nun ist Natascha Wodin selbst fast 80, Friedrich noch älter. Der Alltag mit ihm wird immer beschwerlicher. Er hat ein schwaches Herz, hört schlecht, vergisst viel, er schläft nachts kaum, geistert herum, redet wirr. Und auch Natascha Wodin hat jeden Tag Schmerzen, kann kaum noch laufen, komplexe Tätigkeiten, wie einen Kuchen backen, fallen immer schwerer. Mein Schreibtisch ist der einzige Ort, an dem ich mein Alter, die Schmerzen, die Angst vergesse, obwohl ich darüber schreibe. Ich schreibe darüber, um nicht sang und klanglos zu sterben. Quelle: Natascha Wodin – Die späten Tage Erinnerungen an ein anderes Leben In kurzen, tagebuchartigen Absätzen, erzählt Natascha Wodin von ihren „späten Tagen“ mit Friedrich. Ihren Stil erkennt man sofort wieder: kurze, poetische Sätze, dicht und präzise, oft mit lakonischem Unterton. In die tägliche Realität des alten Paares, mischen sich immer wieder Erinnerungen an ihr Leben. Es geht um gescheiterte Beziehungen, um Freundschaften, ihre Arbeit als Dolmetscherin in Russland und ihren späten Erfolg als Schriftstellerin. Aber auch der furchtbare Krieg gegen die Ukraine beschäftigt sie, schon weil ihre Mutter, die an ihrem Schicksal als russisch ukrainische Zwangsarbeiterin in Deutschland zerbrach und sich das Leben nahm, aus Mariupol stammte . Natascha Wodin schaut dem Verfall direkt ins Gesicht Kulisse des Buches ist ein See in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sitzt das Paar oft und beobachtet die Spiegelungen des Himmels im Wasser, Sonnenuntergänge, Vögel. Ein romantischer Ort, den so völlig kitschfrei wohl nur Natascha Wodin beschreiben kann: Der Himmel spannt sich wie eine blaue Hochglanzfolie über den See, der Wind hat alle Wolken weggeblasen und treibt die schreienden Möwen, die immer auf Fischjagd sind, aus ihren Flugbahnen. Der Schaum der auslaufenden Wellen hinterlässt für Momente das Muster geklöppelter Spitze im Sand. Abends wenn die Sonne untergeht und unser Ufer längst im Schatten liegt, schauen wir aus dem Dämmer hinüber auf die andere Seite des Sees, die noch im Licht liegt. Dort drüben brennt die Welt. Quelle: Natascha Wodin – Die späten Tage Das ist der eigentliche Zauber dieses Buches: dass es nichts beschönigt und trotzdem schön ist. Natascha Wodin schaut dem Verfall direkt ins Gesicht – manchmal verzweifelt, aber nicht verbittert. Die späten Tage ist ein Buch darüber, wie Nähe und Liebe auch dann noch möglich sind, wenn allles andere brüchig wird. Leicht ist es nicht, aber das sind Leben und Liebe ja nie. Das Leben hört nicht auf, lebendig zu sein, nur weil es dem Ende zugeht. Es verändert bloß seine Töne – und Natascha Wodin hört sie alle.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
Wer sich mit dem englischen Naturforscher und Geografen Clarke auf Hasenjagd in den Weiten Patagoniens begibt, muss sich auf einiges gefasst machen. Denn César Aira hat in seinem Roman „Der Hase" gleich ein ganzes Bündel von erzählerischen Konzepten zusammen geführt. Er liefert die Geschichte einer Forschungsreise um die Mitte des 19. Jahrhunderts und zugleich deren Parodie. Doch damit nicht genug: Er reißt alle Grenzen zwischen Wahrscheinlichem und dem phantastisch Herbeifabulierten gründlich ein und zündet ein ebenso einfallsreiches wie sinnverwirrendes Feuerwerk von kuriosen Ereignissen, ethnologischen Spiegelfechtereien und metaphysischen Spekulationen. Irrläufe zwischen Wirklichkeit und Phantasie So ist der sogenannte „Legibrerianische Hase", den Clarke in der Pampa aufspüren will, keineswegs ein schlichter Vierbeiner, sondern ein schwer greifbares Mischwesen aus Gerüchten und magischen Eigenschaften. Von Anfang an wird der Forscher von Zweifeln geplagt: Ich frage mich, ob an dieser Anekdote mit dem Hasen etwas dran ist, ob sie wirklich passiert ist, oder ob es eine Art Aufführung oder Ritual darstellt. Quelle: César Aira – Der Hase Trotzdem schwingt sich Clarke in den Sattel und macht sich mit seinem Gaucho-Führer auf die Suche nach dem ominösen Fabeltier. Wie Don Quichotte und Sancho Pansa bekommen sie es dabei mit einem großen Durcheinander von Wirklichkeit, Fantasien und literarischen Anspielungen zu tun. Viel Betrieb in Patagonien Die patagonischen Weiten, die sie durchqueren, sind keineswegs leer, sondern überfüllt mit indigenen Völkern, kriegerischen Scharmützeln, redseligen Stammesoberhäuptern, überraschenden Verwandtschaftsbeziehungen, Ober- und Unterwelten. Am Lagerfeuer werden abgefahrene Weisheiten und Weltdeutungen ausgetauscht. Die Rede des Kaziken besaß eine Ungewissheit, etwas Unbestimmtes, das seinerseits nicht leicht mit Bestimmtheit auszumachen war. Quelle: César Aira – Der Hase César Aira erschafft, wie es zu seinem Markenzeichen wurde, auch in diesem frühen Roman fiktionale Gegenwelten. Der Naturforscher Clarke wird als Schwager von Charles Darwin vorgestellt, doch anders als dieser kann er keinerlei Material sammeln, das mit Vernunft und Wissenschaft vereinbar wäre. Stattdessen durchquert er ein poetisches Territorium voller vielgestaltiger Tableaus und Handlungsstränge. Ein kunterbuntes Kontinuum Das ist César Airas Schreibprogramm, als "kunterbuntes Kontinuum" hat er seine Texte einmal bezeichnet. In diesem Fall allerdings übertreibt er es mit der endlosen Anhäufung narrativer Winkelzüge, die das Leseinteresse zwar in Atem halten, aber auch ziemlich strapazieren. In seinen späteren Kurzromanen ist die Erzählökonomie meist besser austariert. Hier jedoch fühlt sich sogar der Romanheld von all dem Erfindungsreichtum überfordert und rettet sich in eine der vielen Paradoxien, mit denen sein Autor gerne aufwartet. Ich vermag noch immer nicht klar zu denken. Solche Sachen geschehen nur in Romanen ... Aber Romane geschehen nur in der Wirklichkeit. Quelle: César Aira – Der Hase César Airas Roman „Der Hase" gleicht einem vollgestopften Kuriositätenkabinett. Brillant verspielte Geistesblitze finden sich darin ebenso reichlich wie selbstgenügsamer Nonsense.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Joseph Beuys: Ausstellung widmet sich Werk und Widersprüchen des Künstlers 3:47
3:47  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:47
Menyukai3:47
Beuys-Expertise in der Kunsthalle Tübingen Joseph Beuys, das ist ein Mythos. Der berühmte Skandalkünstler mit Filzhut und Fettecke, der das Kunstverständnis revolutioniert hat. Nun widmet die Kunsthalle Tübingen ihm eine neue Ausstellung: „Joseph Beuys – Bewohnte Mythen“. Mit der Tübinger Kunsthalle ist Beuys dabei kunsthistorisch verbunden: Seit den 1970er-Jahren wurden seine Arbeiten bereits mehrmals dort gezeigt. Der erste Beuys-Biograph verfasste Götz Adriani, der frühere Leiter der Kunsthalle. Und auch die aktuelle Direktorin, Nicole Fritz, promovierte zu Beuys. Kontextualisierung von Beuys' Werken Ein wichtiger Aspekt der Ausstellung sei, Beuys zu kontextualisieren und Kontroversen zu erklären, so Fritz gegenüber SWR Kultur. Das Ansehen des Künstlers hatte in den letzten Jahren besonders wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus und seiner undurchsichtigen Haltung zum NS-Regime gelitten. Die Tübinger Ausstellung konzentriert sich dabei auf die spirituellen Dimensionen seines Werks, die sich wie ein roter Faden durch sein Gesamtwerk ziehen. Der Schwerpunkt liege, so Fritz, auf dem Umgang mit vormodernen Kulturen, Aberglauben und Fragmenten. Mir scheint es, er habe sich sehr viel mit diesem kulturellen Gedächtnis beschäftigt, als wollte er sich da verwurzeln. Es ist in den Zeichnungen zu sehen, dass er diesen Traditionen förmlich nachspürt und Gedankliches und Geistiges versucht, in ein Bild zu fassen. Quelle: Nicole Fritz, Direktorin der Kunsthalle Tübingen Es sind zerbrechliche und zugleich wilde Figuren, die Beuys in den 50er- und 60er-Jahren auf Papier festhielt: Nebelfrauen, Schicksalsgöttinen, Elfen, geheimnisvolle, schwer fassbare Wesen. Berühmte Holzschlitten als Exponat Die Anleihen aus Mythen und Märchen und die Sehnsucht nach Spiritualität und Transzendenz als Reaktion auf die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs, all das hat bei Beuys nichts Rückwärtsgewandtes. So ist in der Ausstellung etwa der berühmte Holzschlitten zu sehen, mit Fett, Filzdecke und Taschenlampe als Notausstattung zum Überleben – möglicherweise eine Kritik an sinnlosem Konsum. Beuys geriert sich als Künstler-Schamane, der bei den Menschen ein neues Bewusstsein zu wecken sucht. Die Idee einer universalistischen Gemeinschaft wohne Beuys' Kunstbegriff bereits inne, findet Fritz. Kontroverses Frauenbild Die Ausstellung will dabei mehr als eine reine Retrospektive sein. Während vor allem die spirituellen Aspekte im Werk des Künstlers im Mittelpunkt stehen, finden auch Kontroversen Platz. So wird Beuys archaisches Frauenbild und auch sein Umgang mit Tieren in der Kunst kritisch hinterfragt. Gerade die Jungen kritisieren, dass wir an dieser Polarität – männlich, weiblich, gefühlige Frau, denkender Mann – nicht mehr festhalten können. Aber ich denke, es ist auch spannend, Beuys als Spiegel der Zeit zu sehen. Quelle: Nicole Fritz, Direktorin der Kunsthalle Tübingen…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Nachtschicht - Eine Reise durch die Nacht 4:33
4:33  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:33
Menyukai4:33
Das Publikum sitzt im Bus Die Türen gehen auf und dick eingepackt steigt das Publikum an einem regnerischen, frostigen Herbstabend ein – in einen Bus. Lokstoff! Das Theater im öffentlichen Raum entführt mit dem Stück „Nachtschicht“ auf eine Reise durch das nächtliche Stuttgart und Umgebung. Mal guckt das Publikum durch die nassen und leicht beschlagenen Scheiben, mal verwandelt sich der Bus selbst in eine Theaterbühne. Bunter Trip durch das düstere Stuttgart Helden spielen in diesem Stück die zentrale Rolle – am Stuttgarter Schlossplatz geht es los – hier stehen zwei, etwas abgehalftert wirkende Helden vor dem Bus, Herakles und Batman. Sie musizieren, plaudern gemeinsam – über die Helden, die Kinderaugen zum Strahlen bringen, aber eigentlich taugen sie nicht wirklich als Vorbild. Dann lassen wir die beiden erschöpft wirkenden Helden zurück und es geht los, auf einen bunten Trip durch das nächtlich düstere Stuttgart. Helden der Gegenwart Von außen mutet der vermeintliche Linienbus mit der Anzeige „Lokstoff – Nachtschicht“ über der Frontscheibe und den Fahrgästen mit blau leuchtenden Kopfhörern sicher eigentümlich an. Zumal wir ja auch von den beiden Helden begleitet werden, die an verschiedenen Stationen immer wieder auftauchen, draußen im öffentlichen Raum agieren und oft auch auf Menschen auf der Straße regieren müssen. Während Batman und Herakles draußen jammern, über das Alter, das an ihnen nagt, ihre schwindende Bedeutung und die damit verbundene Identitätskrise, stoppt der Bus an mehreren Haltestellen und die wahren Helden der Gegenwart steigen ein und erzählen von ihrem Leben. Alltagsheldinnen erhalten Sichtbarkeit Alltagsheldinnen wie Casjupea, die am Klinikum Stuttgart pflegende Angehörige versorgt. Auch Patrizia steigt zu uns in den Nachtschicht Bus. Sie betreut in einer Wohngruppe Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern wohnen können. Und ein paar Kilometer weiter öffnet sich die Türe für Zohra. Sie ist 2013 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, in ihrer Heimat durfte sie wegen der Taliban nicht mehr zur Schule gehen – dank viel harter Arbeit hat sie heute einen Kosmetiksalon. Sie will ein Vorbild sein und zeigen, was Geflüchtete leisten können. Menschen, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde Es ist eine eindrückliche und nachdenklich stimmende Tour, die wir gemeinsam in dem Bus zurücklegen – vorbei an ganz unterschiedlichen Orten der Stadt, an denen man oft vorbeischaut – dem Stuttgarter Hafen oder wir schlängeln uns durch parkende LKW mit schlafenden Fahrern am Großmarkt. Überall Menschen, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Manchmal bleiben wir auch im Verkehr hängen und Busfahrer Andi muss in seiner ungewöhnlichen Nachtschicht einen aufgebrachten Autofahrer beschwichtigen. Stuttgart von einer ganz anderen Seite Am Ende steigen alle aus, reden aber noch angeregt miteinander. Ein Trip, der auch Stuttgarterinnen und Stuttgartern die Stadt noch einmal von einer ganz anderen Seite zeigt. Tourguide Kathrin Hildebrand wünscht sich: „Was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist Zuversicht. Die Menschen sind eigentlich gut. Und wenn wir zuversichtlich bleiben und jeder im Kleinen ein bisschen was macht, ist glaube ich schon ganz viel getan.“…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Yael Ronens gefeiertes Satire-Musical „Slippery Slope“ in Mannheim 3:55
3:55  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:55
Menyukai3:55
Ein verspieltes Stück Rassismus und Machtmissbrauch, Sexismus und kulturelle Aneignung - um all das geht es in Yael Ronens Theaterstück Slippery Slope. Und darüber hinaus um die öffentliche Empörung darüber. Eine eindeutige Trennung in Gut und Böse gibt es allerdings nicht. Keiner der Protagonisten kommt wirklich gut weg am Ende, alle verfolgen im Grunde nur ihr eigenes Interesse. „Es ist ein sehr verspieltes Stück, was mit viel Humor und Ironie auch auf die heutige Debattenkultur einen Blick wirft“, sagt die Regisseurin der Mannheimer Inszenierung Anais Durand-Mauptit. „Wieviel kann man behaupten und spielen, bis wo ist es ok – politisch, moralisch – und ab welchem Punkt verrutscht uns das?“ Der schmale Grad des Sagbaren Alle balancieren auf dem schmalen Grat eines rutschigen Abhangs. Und singen dabei von der genretypischen Ballade über Pop und Hip-Hop bis hin zum Blues – schließlich ist das Stück ja auch ein Musical. Komponist ist Shlomi Shaban. Die Originalinszenierung in Berlin ist auf Englisch, bisherige Nachinszenierungen haben nur die Sprechtexte ins Deutsche übersetzt. In Mannheim hat man sich entschieden, alles auf Deutsch zu machen, sowohl das Sprechen als auch das Singen. Weil beides so oft ineinander übergeht und man einen Bruch vermeiden möchte. Eine Satire, die aktueller ist denn je Es gibt berührende Momente, aber auch viel Trash - wir befinden uns schließlich im Künstler-Karriere-und-Klatsch-Milieu. Entsprechend bewegen sich die Kostüme zwischen Eleganz und Subkultur. Das Mannheimer Inszenierungsteam verspricht eine musikalisch und visuell dichte Revue. Und betont dabei, dass diese Satire über sämtliche Gegenwartsdebatten aktueller ist, denn je.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Migration macht Augenweiden: Großartige Kunst aus dem Exil im Kunstmuseum Stuttgart 12:44
12:44  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai12:44
Menyukai12:44
Rolf Nesch, Nadira Husain und Ahmed Umar haben einiges gemeinsam: Die Vorliebe für haptische, vielschichtige Skulpturen und Materialbilder – und Erfahrungen vom Leben in der Fremde. Wie das eine das andere prägt, davon erzählt eine großartige Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart.
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Neues Album „Lux“ von Rosalía – „Ein absolut wilder Ritt“ 7:14
7:14  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai7:14
Menyukai7:14
Ein wortwörtlicher Lichtschein für Fans der katalanischen Sängerin und Songwriterin Rosalía: Ihr aktuelles Album „Lux“ ist seit dem 07. November auf dem Markt. Begonnen hat die 33-Jährige ursprünglich als Flamencosängerin. Doch ihre Musik hat einen deutlichen Wandel durchlebt. Das sagt auch Musikkritiker Dirk Schneider in SWR Kultur: „Rosalía ist eine ganz bemerkenswerte Künstlerin“ und „jetzt offenbar berühmt und selbstbewusst genug, um mit ihrem vierten Album wirklich was ganz Neues auszuprobieren.“ Das Album wurde gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra aufgenommen. Rosalía singt darauf unter anderem gemeinsam mit bekannten Künstlerinnen wie Björk und drückt sich in verschiedenen Sprachen aus. Für Dirk Schneider insgesamt „zu viel Überwältigungsästhetik“ sowie „mehr Behauptung als Substanz“. Dennoch: „Lux“ bleibe ein ungewöhnliches und aufregendes Album. „Ich finde, man sollte es auf jeden Fall einmal gehört haben, auch, um sich eine eigene Meinung zu bilden.“…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Josephine Baker am Theater Freiburg – „Vieles zugleich“ 5:57
5:57  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai5:57
Menyukai5:57
Baker nutzte ihre Berühmtheit Von ihr könne man lernen, „dass man sein ganzes Leben lang kämpft“, sagt Monika Gintersdorfer. Zum 50. Todestag Bakers hat sie, gemeinsam mit der internationalen Tanz- und Theatergruppe „La Fleur“, ein Tanztheater-Biopic inszeniert, zu sehen am Theater Freiburg. Das Stück versuche zu zeigen, dass Baker vieles zugleich war und dies auch für ihre Zwecke zu verwenden wusste: „Sie nutzt ihre Berühmtheit, ihre Auftritte, um an bestimmte Orte zu kommen. Weil man Josephine Baker öfter auch mal durchwinkt, um so auch geheime Informationen transportieren zu können.“ Gleichzeitig habe Baker immer wieder mit dem Rassismus ihrer Zeit zu kämpfen gehabt. Der weiße Blick des Publikums Bei ihren Konzerten hätte sie auf ein gemischtes Publikum bestanden: „ich glaube, dieser Mut, auch auf Dinge zu bestehen, auch wenn andere noch gar nicht, überhaupt gar nicht so weit sind oder es auch stark ablehnen, das zeichnet sie sehr aus.“, so Gintersdorfer. Daher spiele der exotisierende, weiße Blick innerhalb des Publikums, auch in der aktuellen Inszenierung eine Rolle.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Sebastian Fitzek: „Meine größte Angst ist der Wimpernschlag, der alles verändert“ 14:32
14:32  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai14:32
Menyukai14:32
In „Der Nachbar“ geht es um eine Bedrohung aus allernächster Nähe. Warum tun Sie Ihren Lesern das an, in dieser für viele schon düsteren Zeit? Sebastian Fitzek: „Die Antwort ist natürlich vielschichtig, aber in erster Linie ist das auch wie eine Achterbahnfahrt, eine Katharsis am Ende, wenn man dann aus diesem Waggon, dieser literarischen Achterbahn, aussteigt, sind alle froh, dass sie es überlebt haben, weil dann ja auch die Endorphine ins Blut schießen. Ein guter Thriller beschäftigt sich immer mehr mit dem Leben als mit dem Tod. Quelle: Sebastian Fitzek Das ist bei einem Thriller nicht anders als bei der realen Achterbahnfahrt. Und ein guter Thriller beschäftigt sich auch immer mehr mit dem Leben als mit dem Tod. Und dann am Ende obsiegt ja zumindest zum Teil das Gute.“ Sie haben Ihren ersten Thriller im Jahr 2006 veröffentlicht, „Die Therapie“. Seitdem fast jedes Jahr ein Buch. Haben Sie denn Ihr nächstes Buch schon im Kopf oder auf Papier? Sebastian Fitzek: „Ich habe den Prolog tatsächlich schon geschrieben. Das Ganze könnte in einem Nachtzug spielen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich mag klaustrophobische Räume. Wenn die sich dazu noch bewegen, umso besser. Und das könnte ein Setting sein oder ein Charakter, wie ich lieber sagen würde. Ich glaube, die Geschichte zu kennen, allerdings haben nach 60 Seiten die Figuren ihr Eigenleben, beginnen selbstständig zu denken und zu handeln.“ Sie sagen über sich selbst: „Ich bin ein ängstlicher Mensch. Sonst könnte ich nicht über die Ängste anderer Menschen schreiben“. Welche Ängste haben Sie denn? Ich habe sehr viele Ängste, aber die größte Angst ist es, durch eine Fahrlässigkeit, einen Fehler, völlig unbeabsichtigt, das Leben von anderen Menschen, von der einen auf die Sekunde, zum Schlechteren zu verändern. Durch einen Unfall beispielsweise. Mit anderen Worten: Die schicksalshafte Sekunde, die auch meine Heldinnen und Helden erleiden, die nicht darauf trainiert sind, auf einmal mit einer Situation umzugehen, die sie eventuell, womöglich sogar verschuldet haben, wo sich von der einen Sekunde, von einem Wimpernschlag zum nächsten das Leben um 180 Grad gedreht hat. Meine größte Angst ist die schicksalshafte Sekunde. Quelle: Sebastian Fitzek Haben sich denn Ihre Ängste im Lauf Ihres Lebens verändert? Und sehen wir so eine mögliche Veränderung in Ihren Romanen dann auch? Seit ich Vater bin, haben sich meine Ängste verändert. Davor waren sie viel abstrakter, jetzt sind sie konkreter, sie werden intensiver. Also wahrscheinlich sind sie auch auf Papier härter geworden, aber das heißt für mich nicht unbedingt expliziter. Zum Beispiel Serientäter, Killer und die Tat als solche interessieren mich gar nicht. Mich interessiert, welche psychologischen Auswirkungen eine Tat auf andere Menschen hat. Praktisch alle Ihre Psychothriller sind absolute Bestseller geworden. Wie ist es denn mit so einer Vorgeschichte, ein neues Buch zu veröffentlichen? Was ist dann der Kitzel, wenn das neue Buch rauskommt? Ich muss sagen, ich mag die Phase der Veröffentlichung leider gar nicht. Was ich sehr mag, sind einzelne Momente darin, wie beispielsweise, wenn ich eine Lesung geben darf und auf Leserinnen und Lesern und in Dialog mit ihnen trete. Das ist wunderschön. Viele denken, ich stehe gerne im Rampenlicht, tue ich aber gar nicht. Quelle: Sebastian Fitzek Aber tatsächlich bin ich eigentlich doch am Ende des Tages nach wie vor der Mensch, der sich am Schreibtisch am wohlsten fühlt. Das heißt, den Kick kriege ich schon mal dadurch, dass ich im Rampenlicht stehe. Viele denken, ich stehe gerne im Rampenlicht, tue ich aber gar nicht. Was war die größte Überraschung in Ihrer Zeit, wenn Sie Lesungen, Signierstunden gemacht haben? Gibt es einen Moment, an den Sie sich zurückerinnern? Es gab viele dieser Momente. Es gab dann allerdings einen wahnsinnig bewegenden Moment. Es war in Rostock, wo eine Leserin gar nichts signiert haben wollte, sondern mich einfach nur in die Arme nahm. Sie bedankte sich, weil sie sonst nicht überlebt hätte. Es ging darum, dass sie auf einem Drogenentzug gewesen war und eine Ersatzdroge brauchte, die sie ablenkt. Ich habe gesagt, das waren jetzt nicht meine Bücher, oder wenn, dann war es Zufall. Sie hat das selbst geschafft, aber das sind natürlich Mitteilungen, die einen streckenweise auch überfordern in dieser konkreten Situation, aber das sind genau die Punkte, an die ich mich erinnere. Hätten Sie je gedacht, Ihre Bücher könnten Menschen so helfen? Die meisten Kritikerinnen und Kritiker, sowie Autorinnen und Autoren wissen überhaupt gar nicht, was Bücher bei vielen Menschen bewirken und das wusste ich auch nicht. Man denkt, das sei nur Unterhaltungssliteratur, die man liest, um den Kopf frei zu kriegen. Und das ist normalerweise die Regel. Aber für einige wenige Menschen haben diese Bücher, nicht nur meine, sondern auch alle anderen, eine ganz extreme Bedeutung.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Theater Konstanz erinnert an eine Holocaust-Überlebende: „Wie jede andere hier“ 3:37
3:37  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:37
Menyukai3:37
Der Abiball als Schlüsselmoment Konstanz im Jahr 1932. Margot und Emmy sind beste Freundinnen, an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Sie lieben den Bodensee, sprechen über Jungs und malen sich ihre Zukunft in leuchtenden Farben aus. Dass sich die Welt um sie herum verändert, scheint ihr Leben und ihre innige Freundschaft nicht zu betreffen. Erst als das nationalistische Gedankengut auch an ihrer Schule propagiert wird, beginnt Margot zu verstehen. Es ist einer der Schlüsselmomente des Stücks: der Abiball 1933, bei dem der Schulleiter die Schülerinnen mit den besten Noten nennt. Der Schulleiter wagt es nicht mehr die jüdische Schülerin auszuzeichnen. Sie gehört nicht mehr dazu. Es sind Szenen wie diese, die eine direkte Verbindung zwischen dem Schicksal von Margot Spiegel und dem jungen Publikum herstellen, darunter viele, die selbst kurz vor dem Abitur stehen. Wachsende Ausgrenzung führen zu Zweifeln Her mit dem schönen Leben, das war eigentlich Margots Plan. In Freiburg wollte sie Chemie studieren. Stattdessen geht sie für ein Jahr nach Italien, als Kindermädchen. Und auch die Beziehung zu ihren nichtjüdischen Freundinnen und Freunden verändert sich. Die Schauspielerin Kristina Lotta Kahlert ist eine beeindruckende Margot, die immer mehr an ihrer Identität zu zweifeln beginnt, angesichts ihrer wachsenden Ausgrenzung. Ein Stück, das ins Herz trifft Somaya Ridani bewegt Margots Geschichte. Die Schülerin kleidet sich im Gothic-Look, schwarze Kleidung und schwarzes Make-up, da sind Vorurteile vorprogrammiert, sagt die Abiturientin. Mit Margot Spiegel vergleichen möchte sich die Schülerin nicht. Trotzdem können sie und ihre Mitschüler die Gefühlswelt von Margot Spiegel nachvollziehen. Das ist die Stärke der Inszenierung von Simone Geyer. Parallelen sichtbar und tiefe Gefühle spürbar zu machen. Fazit: Geschichtsbücher sind für den Kopf, die anderthalb Stunden Theater treffen direkt ins Herz.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Ladies in Crime“ – Krimiautorinnen treffen sich in Speyer 3:52
3:52  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:52
Menyukai3:52
Sexismus in der Krimi-Welt Am Anfang war es nur eine Mitgliederversammlung, erzählt Organisatorin Kirsten Sawatzki. Denn die „Mörderischen Schwestern“ gründeten sich als Zusammenschluss von Krimiautorinnen, die sich gegenseitig unterstützten. Als Frau schlage einem da oft viel Skepsis entgegen, berichtet Krimi-Autorin Heidi Moor-Blank. Es wird ihnen nicht so sehr zugetraut, dass sie sehr blutig schreiben können, dass sie richtige harte Krimis schreiben können. Es wird ihnen oft ein geringerer Vorschuss angeboten. Quelle: Krimi-Autorin Heidi Moor-Blank Hunderte Mitglieder bundesweit Der Verein besteht inzwischen aus rund 800 Krimi-Autorinnen, rund hundert von ihnen treffen sich jährlich zum Austausch. Sie beraten sich gegenseitig etwa zur Verlagswahl und unterstützen sich mit Feedback zu aktuellen Schreibprojekten. Von diesem Treffen ausgehend reifte schließlich die Idee eines Festivals heran. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass hundert Autorinnen in eine Stadt kommen und keiner bekommt es mit. Und deshalb haben wir gesagt, hundert Autorinnen, zehn Events, eine Stadt. Quelle: Kirsten Sawatzki, Organisatorin des Festivals und Autorin Expertenwissen zu Tatortreinigung und Cold Cases Auf dem Programm stehen etwa Krimi-Lesungen für Kinder oder Senioren und ein Jugendschreibwettbewerb. Für die Autorinnen gibt es außerdem noch geschlossene Veranstaltungen, bei denen etwa eine Tatortreinigerin und ein LKA-Mitarbeiter, der auf Cold Cases spezialisiert ist, ihre Expertise teilen. Unter den „Mörderischen Schwestern“ ist der Zusammenhalt groß, berichtet Sawatzki. Am Anfang habe sie Sorge gehabt, jemand könne den Austausch missbrauchen, um ihre Ideen zu stehlen. Inzwischen sei sie da entspannter und gebe ihre Manuskripte gerne für Feedback an Kolleginnen. Und außerdem, fügt Moor-Blank mit einem Schmunzeln hinzu, wäre es sehr gewagt, Ideenklau ausgerechnet bei Frauen zu betreiben, die sich so gut mit heimlichen Mordmethoden auskennen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Hitler-Attentäter Georg Elser und der Widerstand im Südwesten 6:54
6:54  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai6:54
Menyukai6:54
Am 8. November jährt sich das Attentat des Schreiners Georg Elser auf Adolf Hitler zum 86. Mal – ein Symbol für den frühen Widerstand gegen das NS-Regime. Laut Journalist Ludger Fittkau hatten die Nazis die Tat zwar sofort den Briten zuschrieben, „aber auch Widerstandskreise wussten, dass der britische Geheimdienst aktiv war und es Pläne gab, Hitler zu töten.“ Viele Zeitgenossen reagierten zwiespältig, denn „1939 herrschte noch eine Dominanz der Führerloyalität, auch in späteren Widerstandskreisen.“ Dennoch gab es schon damals Menschen, die den Mut hatten, Hitlers Sturz zu planen. Fittkau erinnert daran: „Elser handelte allein, aber seine Tat wurde aufmerksam verfolgt – auch von jenen, die später Teil des 20. Juli wurden.“ Die Veranstaltung in Gedenken an den Widerstandkämpfer Georg Elser inklusive Ausstellung findet am 8. November im Alten Rohrlager in Mainz statt.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Hörspiel trifft Zukunft – Die ARD-Hörspieltage 2025 starten 3:41
3:41  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:41
Menyukai3:41
Science Fiction ist das Motto Anouk und Andri sind als Pionierinnen der Menschheit im All unterwegs. Gesucht wird eine neue Heimat, denn der blaue Planet ist quasi unbewohnbar geworden. „Unearthing“ heißt die achtteiligen Science-Fiction-Serie von Erik Wunderlich. Bei ihrer Reise durchs Weltall sollten Anouk und Andri allerdings aufpassen, dass sie nicht mit dem schrottreifen Raumschiff von Lieutenant Quent und seiner chaotischen Crew aus dem Hörspiel „Happiness is a warm spaceship“ zusammenstoßen. Im Ohr entstehen neue Welten Die ARD-Hörspieltage haben mit „Science Fiction“ zum ersten Mal einen inhaltlichen Schwerpunkt gewählt. „Im Hörspiel braucht man keine großen Kulissen, um wirklich aufsehenerregende Effekte zu erzielen. Die Welten entstehen im Kopf“, erklärt die neue Leiterin des Festivals, Mareike Maage, vom Südwestrundfunk „Dafür sind das Radio und das Hörspiel einfach fantastisch geeignet." „Der Krieg der Welten“ von Orson Welles Und weil Science Fiction seit den Anfängen im Hörspiel besonders beliebt ist, soll in der „Nacht des Hörspiels“ am Samstag eine kleine Zeitreise unternommen werden: „Wir gucken auf Musiken, die in Science-Fiction-Filmen und auch im Hörspiel verwendet werden. Dann gucken wir auf Science Fiction in der DDR“, sagt Maage. „Außerdem schauen wir auf neue Erzählformen und aktuelle Trends unter den Autoren.“ Und natürlich darf, wenn man über Science Fiction im Hörspiel spricht, „Der Krieg der Welten“ von Orson Welles nicht fehlen – den Klassiker gibt es bei dem Festival als Live- Hörspiel, in einer Fassung von Oliver Rohrbeck und der Lauscherlounge . Neun neue Hörspiele werden im ZKM Karlsruhe vor Publikum präsentiert Doch Hörspiel kann natürlich nicht nur Reisen in die Zukunft, sondern zum Beispiel auch Bahnfahrten an die Ostsee. Das Hörspiel „Windstärke 17“ nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Caroline Wahl eröffnet am Freitagvormittag den Reigen der öffentlichen Hörspiel-Vorführungen. Insgesamt neun Neuproduktionen haben ARD, Deutschlandfunk, SRF und ORF für das Festival ausgewählt. Die Hörspiele werden in ganzer Länge vor Publikum im „Klangdom“ des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien präsentiert – und dann mit den Macherinnen und Machern besprochen. Um die Zukunft des Hörspiels muss man nicht fürchten Das Hörspiel ist ein überaus vielfältiges, wandlungsfähiges Medium, dass sich im Verlauf seiner Geschichte immer wieder durch neue Produktionsmöglichkeiten und Nutzungsverhalten seiner Fans verändert hat, sagt Festivalleiterin Mareike Maage: „Das Hörspiel ist so ein breites und agiles Instrument, mit dem Kunst gemacht wird, dass ich wirklich nach wie vor begeistert bin, was da für Produktionen herauskommen und was für Impulse gesetzt werden.“ Um die Zukunft des Hörspiels muss man also nicht fürchten. Nicht so lange Menschen gerne Geschichten erzählt bekommen, wie die Hörspiel-Serie „1001 Nacht“ belegt: Du kannst jetzt nicht aufhören, zu erzählen – deine Geschichte ist so unglaublich spannend! Und Schahrasad antwortete: Das ist noch gar nichts gegen das, was ich euch morgen Nacht erzählen werde! Quelle: Hörspielserie 1001 Nacht…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Bücherfestival Baden-Baden: Carsten Otte im Gespräch mit Kaleb Erdmann („Die Ausweichschule“) 5:40
5:40  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai5:40
Menyukai5:40
Verarbeitung des Amoklaufs am Erfurter Gutenberggymnasium Als „heiteres Trauerbuch“ beschreibt Otte den Roman, der in diesem Jahr auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Er handelt vom Amoklauf am Erfurter Gutenberggymnasium 2002, den Autor Kaleb Erdmann selbst miterlebt hat. Für Carsten Otte ist „Die Ausweichschule“ deshalb auch ein autofiktionaler Roman über die Grenzen des Schreibens. Einer in dem die Tat aus Sicht des elfjährigen Erzählers geschildert wird. Der Amoklauf habe in den Schülerinnen und Schülern lange nachgewirkt, „in ihnen gegärt“, aber Kaleb Erdmann habe auch „diesen wunderbaren Roman geschrieben“, so Carsten Otte.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Zu Gast bei den ARD Hörspieltagen: Der Hörspielkünstler und Synchronsprecher Oliver Rohrbeck 14:30
14:30  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai14:30
Menyukai14:30
40 Jahre Justus Jonas aus „Die drei ???“ Justus Jonas in der Hörspielserie „Die drei ???“ spielt Oliver Rohrbeck seit über 40 Jahren. Daneben sprach er in unzähligen Filmen wie „Grisu der Kleine Drache“, Gru in „Ich – Einfach unverbesserlich“ und er ist die deutsche Stimme von Ben Stiller. Daneben inszeniert er Live-Hörspiele mit tausenden von Besuchern. In SWR Kultur am Abend spricht Oliver Rohrbeck darüber, wie er es schafft, auch noch als Sechzigjähriger den Jugendlichen Justus Jonas aus „Die drei ???“ zu spielen. Er versuche dafür nicht, seine Stimme jünger zu machen, sondern finde aus einer schauspielerischen Spielhaltung heraus in die Rolle des Achtzehnjährigen, sagt er. Orson Welles Radioevent „Krieg der Welten“ als Live-Hörspiel Auf den ARD-Hörspieltagen knüpft Oliver Rohrbeck an das historische Radioevent „Krieg der Welten“ von Orson Welles aus dem Jahr 1938 an. Rohrbecks neues Live-Hörspiel bezieht die Rezeption des damaligen Events mit ein und wirft aktuelle Fragen auf zur Glaubwürdigkeit der Medien angesichts wachsender Ängste in der Bevölkerung.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Psychologische Studie zu „D-Faktor“: Wie böse bin ich? 7:34
7:34  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai7:34
Menyukai7:34
Ein Faktor statt zahlreiche Eigenschaften „D-Faktor“ steht für „dark“, also englisch für „dunkel“. Er steht für Persönlichkeitsmerkmale, die zu bösem Verhalten führen – auf englisch „dark traits“. Prof. Benjamin Hilbig hat mit seinem Team der Rheinland-Pfälzischen Technische Universität Kaiserslautern-Landau genau dieses Phänomen untersucht – ausgehend von der Beobachtung, dass vermeintlich unterschiedliche Formen „böser“ Persönlichkeiten sich nach wissenschaftlicher Betrachtung als sehr ähnlich herausstellen. Wir wollen die Forschungslandschaft ein bisschen aufräumen. Denn es ist ineffizient, mit etwa 25 bösen Eigenschaften zu hantieren, wenn man de facto nur einen Wert braucht, nämlich den D-Faktor Quelle: Prof. Benjamin Hilbig, RPTU Kaiserslautern-Landau Selbsttest für den „D-Faktor" Mit einem Fragebogen untersuchten Hilbig und sein Team verschiedene Aspekte dieser „bösen“ Tendenzen. Darunter etwa: Sind Sie der Meinung, dass man es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen sollte? Oder: Können Sie sich vorstellen, dass es Spaß machen würde, andere Leute zu quälen? Fast drei Millionen Menschen weltweit haben den Fragebogen bisher ausgefüllt und Hilbig damit Daten für seine Forschung geliefert. Das große Echo erklärt sich Hilbig im Gespräch mit SWR Kultur unter anderem mit dem Interesse vieler, den eigenen „D-Faktor“ herausfinden zu wollen, und das anonym. Bösartigkeit nimmt im Alter ab Denn Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmende lassen sich aus dem Datensatz nicht ziehen. Dafür aber wissenschaftliche Erkenntnisse: So etwa, dass bösartige Anteile in der Persönlichkeit ohne weiteres Zutun mit dem Alter abnehmen. Auch gesamtgesellschaftlich lassen sich Schlüsse ziehen, so Hilbig. So förderten bestimmte Umwelteinflüsse den „D-Faktor“ der Bevölkerung. So seien etwa mangelnde Rechtsstaatlichkeit oder weit verbreitete Kriminalität Bedingungen, unter denen das Individuum mit einem höheren „D-Faktor“ im Zweifelsfall Vorteile habe - schlichtweg, weil es existenziell notwendig sei, sich gegen andere durchzusetzen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch: Wir dämmen den „D-Faktor“ auf gesamtgesellschaftlicher Ebene am ehesten ein, indem wir verhindern, dass es existenziell bedrohliche Armut oder Unsicherheit gibt. Quelle: Prof. Benjamin Hilbig, RPTU Kaiserslautern-Landau…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? | Buchkritik 4:09
4:09  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:09
Menyukai4:09
Ja, es ist ein verzweifelt Ding mit der Wahrheit in diesen Zeiten von Fake News und Phishing. Eine Professorin für Strafrecht und Direktorin für Medienrecht hat sich der Thematik nun angenommen und der Verlag meint: Es sei fünf vor zwölf. In diesem Buch wird es um Wahrheit und Lügen in den großen Kommunikationsräumen gehen, in den Medien und in der Politik, um Lügen über den Klimawandel, das Corona-Virus und Kriege, um Fake News, Verschwörungserzählungen und Deepfakes, aber auch über die Wahrheit im Privaten, über Lügen für Geld oder für Sex. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Lüge in der Politik … Dass Lügen in der Politik, angeführt an vorderster Front von den USA, das Klima vergiften, die Köpfe verdrehen und die Unwahrheit erst hoffähig gemacht haben, streift Elisa Hoven auch. Dann richtet die Autorin ihren Blick auf deutsche Missstände. Wer nach einer gewonnenen Wahl das Gegenteil von dem tut, was er im Wahlkampf angekündigt hat, der sägt an der Glaubwürdigkeit der Politik und bereitet radikalen Parteien den Boden. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Propaganda in Kriegszeiten Und beim Blick zu den dominierenden Kriegsschauplätzen dieser Welt, in die Ukraine und nach Gaza, verhehlt die Juristin nicht jene Erkenntnisse, die in kurzatmiger, tagespolitischer Aufgeregtheit rasch verteufelt werden. Es ist erstaunlich, dass die Aussage – Kriegsverbrechen werden von allen Seiten begangen – überhaupt ernstlich in Zweifel gezogen wurde. Wer sich mit internationalen Konflikten beschäftigt hat, der weiß, dass es in jedem Krieg Kriegsverbrechen gibt, und dass keine Seite davor gefeit ist. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Plädoyer für den Zweifel Sahra Wagenknecht ist für diese Erkenntnis einst mächtig gescholten worden. Elisa Hoven behauptet, etwas naiv vielleicht, wir hätten „eine freie Presse, die weder aus der Politik noch aus der Wirtschaft gesteuert“ werde – die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen benennt sie nicht; doch sie warnt vor Gleichförmigkeit und Anpassung in Berichterstattung und Kommentar. Frank-Walter Steinmeier sprach vor über zehn Jahren, 2014, vom hohen „Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten“. Dieser führe zur Verengung des Meinungsspektrums, ja Aussparung unliebsamer Aspekte. Um der Wahrheit künftig wieder mehr Gewicht zu verschaffen, plädiert Elisa Hoven – neben Maßnahmen der Justiz und Gesetzgebung - vor allem für: den Zweifel! Und damit kann sich dann jede und jeder angesprochen fühlen. Das notwendige Gegengewicht zu Lügen und Fake News ist nicht die unbedingte Forderung nach Wahrheit, sondern der Zweifel, die Ausgewogenheit und der kritische, plurale Diskurs. (…) Wir brauchen eine neue Kultur des Zweifelns, in der nicht die Gewissheit, sondern die Suche nach der Wahrheit im Vordergrund steht. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Gesetze als Lösung? Die vielen Betrugsversuche und Täuschungsmanöver im Netz könnten (oder sollten zumindest) den Benutzern bekannt sein – warum aber wirken diese jüngeren Generationen gefügiger und kritikloser gegenüber Angeboten und Texten im Internet als frühere Nutzer von Texten in Zeitungen und Büchern oder auf Werbeplakaten? Diese Frage stellt sich die Autorin nicht. Oder auch: Was ist gegen das Suchtverhalten der online-Gesellschaft zu unternehmen? Und was gegen die infame Geschäftspolitik von Herrschern im Silicon Valley? Aus Sicht der Juristin, „Forschungsgebiet: Kriminalität und Strafrecht“, wie sie schreibt, macht sie verschiedene Vorschläge für Verschärfungen und Ergänzungen in Gesetzestexten, denn das Recht hinke „den aktuellen Entwicklungen hinterher“. Mitunter verliert sie sich dabei in juristische Spitzfindigkeiten, zudem vertraut sie der eigenen Berufsklasse über alle Maßen: „Menschen neigen dazu, ihre eigene Gruppe zu begünstigen“, schreibt sie zunächst, „bei Richterinnen und Richtern dürften diese Effekte geringer sein als bei anderen, denn ihre Rolle erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexion.“ Gegen diese Einschätzung könnte man juristische Parteinahmen für Mietumwandlungen oder Rechtsprechung in Verkehrsdelikten anführen. Das Buch von Elisa Hoven gibt einen Überblick zur Problematik. Tiefergehende Ursachenforschung, auch aus psychologischer Sicht beispielsweise, könnte diese Bestandsaufnahme künftig ergänzen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Der Tod ist ein Arschloch“: Filmdoku über alternativen Bestatter eröffnet Mainzer Festival „Filmz“ 3:53
3:53  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:53
Menyukai3:53
Blick auf das Menschliche in unserer Begräbniskultur Ein moderner Wohnkomplex in Berlin. Schneetreiben. Ein Mann und eine Frau klingeln. Die Kamera bleibt draußen, vor dem Gebäude, vor der Wohnungstür. Nur ihre Stimmen sind zu hören, während die Fassade mit ihren stummen Fenstern im Bild bleibt. Maria Schuster und Eric Wrede vom Bestattungsinstitut „Lebensnah“ stellen sich vor: „Wir wollten nur einmal schnell gucken, wo Frau Kord ist, gucken, wie wir sie am besten abholen können.“ Die Abholung der toten Frau Kord findet nur im Kopf des Zuschauers statt. Ihre Leiche sieht man dabei nicht. Der Dokumentarfilm „Der Tod ist ein Arschloch“ richtet den Blick auf das Menschliche in unserer Begräbniskultur. Empathie für die Angehörigen, aber auch für die Toten. Ein ehemaliger Bandmanager gründet ein Bestattungsunternehmen Das ist, was sich das alternative Bestattungsunternehmen „Lebensnah“ mit seinem Gründer Eric Wrede auf die Fahnen geschrieben hat. „ Es ist Irrsinn, wie viele Menschen mit einer althergebrachten Form des Bestattens überhaupt nichts anfangen können“, sagt Wrede. „Wir haben ja von Anfang an versucht, Abschiede so anzubieten, wie wir selber es gerne hätten.“ Eric Wrede, ein ehemaliger Bandmanager, arbeitet mit drei Bestatterinnen, die auch einen beruflichen Neustart gewagt haben. Ihre Erfahrungen aus Werbung, Kosmetik und Kunst bringen sie mit ein. Die frühere Fernsehschauspielerin Maria Schuster etwa begleitet die Beerdigungen nun musikalisch. Lange Entstehungsphase des Dokumentarfilms Die Idee zum Dokumentarfilm entwickelte der Mainzer Regisseur Michael Schwarz über Jahre. Ein Auslöser: eine Lesung zu Eric Wredes Buch „The End“. Erfahrungen aus dem persönlichen Umfeld mit weniger empathischen Bestatterinnen bewogen ihn dazu, dem Bestatter eine lange E-Mail zu schreiben. 2020 gingen die Recherchearbeiten los. „Ich bin wirklich wochenlang mitgelaufen und habe im Prinzip so eine Art von Praktikum dort gemacht“, erinnert sich Michael Schwarz. Neue Medienförderung unterstützte Projekt Ausdauer und Hingabe prägen auch die Karriere von Michael Schwarz. Nach ersten Jobs bei der Bavaria Filmproduktion studiert er in Mainz Theaterwissenschaften und entdeckt dort an der Filmklasse den Dokumentarfilm für sich. 2009 gründet er mit einem Studienfreund die Produktionsfirma Nachtschwärmerfilm. Die produziert zur Hälfte Imagefilme, zur anderen Hälfte freie Kinodokumentarfilme; lange ein Risiko, da es in Rheinland-Pfalz keine Filmförderung gab. Erster Dokumentarfilm, der das Festival „Filmz“eröffnet Das änderte sich 2021 mit der Medienförderung Rheinland-Pfalz. „Man merkt jetzt gerade, da kommt auch so ein richtiger Schwung rein“, sagt Michael Schwarz. „Alle sind richtig motiviert, spannende Projekte zu machen.“ Eines der ersten geförderten Projekte war „Der Tod ist ein Arschloch“. Jetzt eröffnet das Werk das Festival „Filmz“ – als erster Dokumentarfilm. Michael Schwarz kann dabei mit großem Zuspruch rechnen – nicht nur, weil Mainz für ihn ein Heimspiel ist, sondern auch, weil es zum Thema Tod offenbar großen Redebedarf gibt.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Fotoklassen der Kunsthochschulen – Famose Fotoausstellung „Playlist“ rockt die Staatsgalerie Stuttgart 3:55
3:55  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:55
Menyukai3:55
Einladung an die Fotoklassen Wenn eine Klasse einer Kunsthochschule die Einladung bekommt, in einer veritablen Staatsgalerie auszustellen, dann ist das ein Angebot von der Sorte, die man nicht ablehnen kann. Obwohl vom ersten Moment an der Druck im Raum stand, dass auf so einem Niveau einfach alles klappen muss; schildern die Stuttgarter Studentin Xenia Wahl und ihre Fotografie-Professorin Ulrike Myrzik von der Akademie der Bildenden Künste am Weißenhof. Die Einladung der Staatsgalerie ging parallel auch an die Professorin Anja Weber von der Stuttgarter Merz-Akademie. Es mussten sich also zwei Fotoklassen erst einmal zusammenraufen – 30 Studierende mit teils völlig unterschiedlichen Hintergründen und Herangehensweisen. Genau darin liegt aber auch der Reiz des Projektes, so Weber. Wie schaut die Gen Z auf diese Welt? Anja Weber: „Die meisten sind aus dieser Generation, die eigentlich vollständig im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist und die auch eben diese Corona-Pandemie sehr stark abbekommen haben. Und diese Lebensrealitäten dieser Studierenden, die wollten wir anerkennen erstmal und schauen, wie gucken die eigentlich auf die Welt.“ Schlüsselbegriff und gleichzeitig Titel der Ausstellung ist „Playlist“ – eigentlich eine persönliche Auswahl von Musiktiteln, digital zusammengestellt. Für die Ausstellenden steckt in „Play“ und „List“ die Spannung zwischen individuellem Spiel und äußeren Faktoren wie Einordnen und Bewerten, erklärt Anja Weber. Das wird an Themen wie Diskriminierung und Gleichberechtigung durchgespielt: Frauen im Handwerk, Powergirls in feministischen Rock-Bands, Lebensfreude und Stärke von Musliminnen. „Playlist“ schlechter Nachrichten aus der Ukraine Mitten aus dem aktuellen Weltgeschehen kommen die Bilder von Mariia Sviatohorova . Die Ukrainerin, die seit zweieinhalb Jahren in Stuttgart studiert, hat Heimatbesuche bei ihren Eltern in Kiew fotografiert. Hier bedeutet „Playlist“ die zermürbende Dauerschleife von Angst und schlechten Nachrichten. Nicht-Ukrainer haben das Privileg kleinerer Sorgen. Xenia Wahl hat Wachsblöcke auf den Fußboden gestellt, in denen Fotos eingeschmolzen sind – unscharfe, im Trüben versinkende Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit. Utopische Power kommt aus der Musik Für die schönen Momente ist in der Ausstellung „Playlist“ immer wieder die utopische Power zuständig, die jede Generation aufs Neue in ihrer Musik findet. Hier sind es ziemlich punkige, rebellische Sounds, wie von der Londoner Frauen-Anarcho-Band „Petrol Girls“. Deren Song „Sister“ endet mit einem Dreiklang von Worten, auf die sich wohl alle Akteure dieser hinreißend quirligen und schillernden Playlist einigen können: Freundschaft, Solidarität, Liebe.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Meister der Apokalypse“ – ARD-Doku zum 70. Geburtstag von Roland Emmerich 2:49
2:49  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai2:49
Menyukai2:49
Stimmung am Set mir Emmerich ist top Über Roland Emmerich sprechen die, die mit ihm direkt gearbeitet haben, eigentlich immer in den höchsten Tönen: Mel Gibson, Jeff Goldblum, sein ehemaliger Co-Autor Dean Devlin oder der Effektmeister Volker Engel: die Stimmung am Set immer top, die Ansagen klar, die Vision nachvollziehbar. Und die Erfolgsbilanz ist trotz oft mäßiger Kritik atemberaubend. Emmerich wird immer noch unter den Top 20 der Hollywood-Regisseure geführt, die die meisten Gewinne eingefahren haben. Da kann man ihm ein bisschen Exzentrik durchgehen lassen. Anfang als Ausstatter bei der Filmhochschule München Roland Emmerich hat beeindruckende Häuser in Los Angeles und London. Als Kunstsammler erwirbt er auch Skurrilitäten wie chinesische Propaganda-Art. Der, der mal als Ausstatter bei der Filmhochschule München angefangen hat, legt Wert darauf, Dinge, die möglicherweise am falschen Platz stehen, zurecht zu rücken. Sein langjähriger Wegbegleiter Jo Müller zeigt ihn als einen Regisseur, der auch über seine Filme und deren Wirkung immer wieder nachdenkt. „The day after tomorrow“ von 2004 wurde der erste Popcorn-Klimakatastrophenfilm. In dem Zusammenhang sprach Emmerich vergangenes Jahr zum ersten Mal in einem Interview von einem überstandenen Hirntumor und wie das seinen Blick auf Filme und das Leben verändert habe. In der Doku tritt er einem immer wieder als ziemlich geerdeter Privatmensch entgegen. „Schwäbischer Alien“ in Hollywood Man muss seine Filme nicht lieben, um seine Biografie und seinen Erfolg als Summe richtiger Entscheidungen zu betrachten: Als Spross einer Stuttgarter Unternehmerfamilie war der Schritt nach Hollywood ein kalkulierbares Risiko. Als schwäbischer „Alien“ ist er dort gelandet und genau wie seine Schwester, die seine Filme produziert, in den USA heimisch geworden. Wurde er anfangs noch als „Spielbergle aus Sindelfingen“ belächelt, ist Emmerich schon lange seine eigene Marke. Mag sein, dass ihn viele vor allem mit Special Effects verbinden, mit Untergangsgrusel und einer flachen und klischeebeladenen Handlung und dass zuletzt die ganz großen Erfolge ausgeblieben sind. Andererseits steht er in der Tradition von Regisseuren, die mit emotionalen Geschichten aufwühlende Themen anpacken. Der Klimawandel treibt ihn um. Die Warnung vor unvernünftiger, profitgeiler Politik. Das Weiße Haus hat er in seinen Filmen schon mehrfach in die Luft gehen lassen. Spannender Mix von Dokumentation und Interviews Die Doku mixt immer wieder hochspannende Aufnahmen von früheren Dreharbeiten, kurze ältere Interviewschnipsel mit Blicken in Emmerichs Seelenleben kurz vor seinem 70. Geburtstag. Dazu gehört der offene Umgang mit seiner Homosexualität, der einem im Filmgeschäft auch im Weg stehen könne Insgesamt ist „Meister der Apkalypse“ eine Hommage an einen weltoffenen, engagierten Skeptiker, der trotz Zweifel an der menschlichen Lernfähigkeit das Leben feiert, der sich die Neugier bewahrt hat für Technik, junge Menschen und ihre Ideen und sich in einem aufgeregten, häufig oberflächlichen Umfeld nicht hat von seinem Weg abbringen lassen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Rotz und Wasser im Kinosessel – Das IFFMH feiert die Emotionen des Films 7:10
7:10  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai7:10
Menyukai7:10
Kino löst Gefühle aus Festivalleiter Sascha Keilholz erklärt, das Motto der Retrospektive „Rotz und Wasser“ passe perfekt zum diesjährigen Schwerpunkt, denn: „Wir beschäftigen uns mit der Emotionsmaschine Kino und den Gefühlen, die das Kino in uns auslöst.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Keilholz von einer neuen Generation Filmschaffender, „die einen eigenen Rhythmus haben, ein eigenes Tempo und ihre persönlichen Geschichten erzählen.“ „Ein großes Jahr für Dokumentarfilme“ Auch der Dokumentarfilm spiele eine zentrale Rolle, betont er: „Es ist ein großes Jahr für Dokumentarfilme – und zugleich eine schöne Gelegenheit, unsere Tradition neu zu beleben.“…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht 4:09
4:09  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:09
Menyukai4:09
Kaum etwas ist überliefert über die drei Tage, die Konstantinos Kavafis im Paris der Belle Époque verbrachte. Im Juni 1897 war er 34 Jahre alt und befand sich mit seinem älteren Bruder auf einer Europa-Reise. Kavafis, der bis heute griechische Schriftsteller und Schriftstellerinnen inspiriert, war damals noch weit entfernt vom Ruhm, seine Lyrik war unausgereift und mittelmäßig. Genau dies, die literarische Suche, die Irrungen und Wirrungen des jungen Dichters, interessieren die Romanautorin Ersi Sotiropoulos. Was mich, und ich glaube uns alle, fasziniert, ist die Frage, wie ein Künstler (…), vom Typ her wohl eher scheu, unterdrückt in seinem Privatleben und gequält von Widersprüchen und inneren Zweifeln (…), diesen Sprung geschafft hat. Wie wird er zu dem Kavafis, den wir kennen? Quelle: Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht Kavafis in Paris – ein rauschhaftes Schlüsselerlebnis In „Was bleibt von der Nacht“ imaginiert sie Kavafis Paris-Aufenthalt als rauschhaftes Schlüsselerlebnis für seine künstlerische und auch für seine persönliche Entwicklung. Sie beschreibt, wie der Grieche aus dem provinziellen Alexandria durch die Straßen der pulsierenden französischen Hauptstadt streift und sich in ihnen verliert, wie dabei äußere Eindrücke und Kavafis komplexe Innenwelten immer wieder verschwimmen: Innenwelten, die von unfertigen Versen, Kindheits-Erinnerungen und erotischen Fantasien bevölkert sind. Zwar schreibt Sotiropoulos über den Dichter in der dritten Person, aber sie schaut nicht von außen auf ihn, sondern nimmt seine Perspektive ein. Eine Locke des jungen Tänzers war über die Rückenlehne des Sessels geglitten. Weiches, frisch gewaschenes Haar mit hell schimmernden Strähnen. Und da war so etwas wie ein Duft, himmlisch, der hin und wieder zu ihm herüberwehte. (…) Er atmete tief ein und schloss die Augen. Ein Duft nach Milch und frischem Getreide. Quelle: Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht Schaffensdrang und Selbstzweifel Konstantinos Kavafis homosexuelles Begehren zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Die Autorin schildert es als intensive und unausgelebte Leidenschaft, die den Lyriker mal beglückt, mal an den Rand des Wahnsinns treibt. Später wird es Kavafis gelingen, über sein erotisches Begehren zu schreiben – ja, dieses wird zu einer treibenden Kraft für seine Poesie. Das Schwanken zwischen überbordendem Schaffensdrang und quälenden Selbstzweifeln, das verzweifelte Ringen um eine eigene literarische Stimme – Ersi Sotiropoulos Darstellung der inneren Kämpfe des Dichters ist durchaus überzeugend: Verfluchte Adjektive, dachte er. Verfluchter Reim. Etwas früher war ihm der Gedanke gekommen, dass diese ganzen Schwierigkeiten beim Schreiben vielleicht gar nicht vom Schreiben selbst herrührten. Vielleicht war es ein ihm eigenes, ein inneres Problem. Dieses starke Bedürfnis nach einem Bruch in seiner Dichtung (…), dieser irrationale Drang, die Regeln zu verletzen (…), sich von den Lyrismen und der überladenen Sprache zu befreien. Quelle: Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht Meisterhafte Beschreibung von Menschen und Orten So wird in dem Roman Kavafis Blitzbesuch in Paris zu einem Befreiungsschlag und das Jahr 1897 zu einem Wendepunkt in seinem künstlerischen und persönlichen Werdegang. Konstantinos Kavafis hat nichts Schriftliches über jene Tage hinterlassen – aber Ersi Sotiropoulos ist eine originelle und tiefschürfende Fiktionalisierung gelungen. Sie nähert sich der Person des Dichters mit so viel Einfühlungsvermögen, Empathie und Kenntnis seines Werks, dass sie das Interesse der Lesenden weckt. Darüber hinaus lässt die Autorin durch ihre meisterhafte Beschreibung von Menschen und Orten das Paris des fin de siècle aufleben, mit seiner Atmosphäre von Lebensfreude, Hedonismus, Frivolität und Dekadenz. Auch deshalb ist „Was bleibt von der Nacht“ ein lesenswertes und reizvolles Buch.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Fans auf der falschen Seite – Bilder von Carl Weisgerber waren bei den Nazis beliebt 3:16
3:16  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:16
Menyukai3:16
So waren Bilder Weisgerbers auf den großen Ausstellungen zwischen 1938 und 1944 zu sehen; Adolf Hitler selbst hat Werke ankaufen lassen. Wie Carl Weisgerber zu den Nationalsozialisten stand, ist nicht bekannt. Was bedeutet diese Gemengelage für seine Kunstwerke heute?
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Inklusiver Theaterabend am Schauspiel Stuttgart: „Schichtwechsel“ 3:41
3:41  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:41
Menyukai3:41
Sie lernen dabei aufeinander zuzugehen und gegenseitige Fähigkeiten zu entdecken. „Schichtwechsel“ ist ein mitreißender und witziger Abend, der von Themen wie Überforderung, Einsamkeit oder der Endlichkeit des Lebens erzählt. Aber auch davon, wie die unterschiedlichsten Formen der Ausgrenzung aussehen können.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Rote Sterne überm Feld“ – Aufregendes Filmdebüt von Laura Laabs 4:11
4:11  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:11
Menyukai4:11
Einer der schönsten Filme des deutschen Kinojahres Der spektakuläre Auftakt, der früh bezaubert, lässt sofort an Alexander Kluges und Jean Luc Godards Montagefilme denken und signalisiert, dass man es hier nicht mit gewöhnlichem deutschem Kino zu tun hat. Es schwebt wieder ein Engel über Berlin, ganz zu Beginn dieses Films. Es muss der Engel der Geschichte sein, denn er spricht, abwechselnd mit den Stimmen einer Frau und eines kleinen Mädchens, die berühmten Zeilen aus Walter Benjamins Thesen „Über den Begriff der Geschichte“: Dazu sehen wir ein paar zentrale Begriffe in Neonschrift zu einem langsamen Flug über das Berlin von heute. Ein Auftakt, der das Niveau anzeigt, das dieser mit dem Max-Ophüls-Preis der Filmkritik ausgezeichnete Film nie verlassen wird. Und doch bricht er das Niveau ironisch, setzt Zeichen für Humor und Unterhaltung und gibt seinem Publikum von Anfang an das Gefühl, einem Film sich anvertrauen zu können, der es ruhig und sicher bei der Hand nimmt – so wie ein Engel seine Schutzbefohlenen. Die linke Aktivistin Tine kehrt nach Bad Kleinen zurück Gleich darauf kommt der Film auf dem Boden der irdischen Tatsachen an. Denn nun hat alles eine sehr gradlinige, einfache Struktur: Hauptfigur Tine, eine junge Frau und linke Aktivistin, kehrt an den Ort zurück, den sie einst verließ, und wird dort mit ihrer verdrängten Vergangenheit konfrontiert – der Mutter, die einst verschwand; der Familiengeschichte –, wie zugleich mit den Gespenstern der deutschen Geschichte. Alte Briefe kommen zum Vorschein, Geheimnisse werden gelüftet, Geschichten erzählt. Eine Moorleiche wird gefunden, die Verführer-Figur des mythischen Erlkönigs taucht auf, diverse Szenen spielen auf das filmische und kulturelle Gedächtnis wie auf historische Erinnerungen an. Darum geht es hier: Um den geschichtlichen Möglichkeitssinn, die lebendigen Widersprüche im Vergangenen und um die Präsenz der Vergangenheit und ihre Möglichkeiten in der Gegenwart. Es geht um die Frage, was eigentlich dabei herauskommt, wenn man zurückblickt. Drei Zeitebenen: NS-Diktatur, DDR und Nachwendezeit Dies alles visualisiert die Regisseurin. So spielt „Rote Sterne auf dem Feld“ zu verschiedenen Zeiten: Der NS-Diktatur; der DDR und ihrer Abwicklung nach der Wende 89/90, der RAF, deren Mitglieder zum Teil im Osten neue Identitäten bekamen, sowie der Gegenwart, aus der auf all dies zurückgeblickt wird. Tine fungiert dabei auch als eine Art Führerin des Publikums durch diese verschiedenen Zeiten. Jedes Mal fragt sie nach Gerechtigkeit und nach den Möglichkeiten der Veränderung. Kampf um die LPG Glücksstern Die vielleicht interessanteste Episode ereignet sich zwischen 1990 und 1993: Zur Erbmasse der DDR gehören auch die LPGs. landwirtschaftliche Genossenschaften, die den neuen Herren ein Dorn im Auge sind. Der Leiter der örtlichen LPG will bei der Abwicklung nicht mitmachen und formiert Widerstand. Warum soll man auch die eigenen Tomatenfelder stilllegen, um dann holländische Tomaten im neuen Westsupermarkt zu kaufen? Es ist faszinierend, wie souverän und virtuos die Regisseurin Laura Laabs all das stilistisch zusammenhält und es glückt, dass man nie die Orientierung verliert. Sehr persönlicher Film von Laabs Regisseurin Laabs wirft erstaunlich sinnvoll Einfälle aus Philosophie und Politik, Geschichte und Gegenwart, Utopie und Zeitgeist zusammen. Das Ergebnis sieht manchmal aus wie „Twin Peaks“, mal wie „Midsommar“, mal wie „Das weiße Band“. Aber es ist alles andere als ein kühl kalkulierter Pop-Zitate-Strom. Vielmehr ein gradliniger und persönlicher Film, bei dem man spürt, dass er der Regisseurin am Herzen liegt, und so geworden ist, wie er ist, weil er so werden musste. Trailer: Rote Sterne überm Feld „Rote Sterne übermm Feld“ ist keineswegs perfekt, und nimmt doch sehr für sich ein, weil er experimentell ist und Dinge ausprobiert, sehr viele neue Einfälle hat, deren meiste gut funktionieren – und weil er anspruchsvoll ist. Dies ist endlich einmal ein deutscher Film, dem an neuen Ausdrucksformen und einem besseren Kino gelegen ist. Das Ergebnis ist ein wilder, bezaubernder Film – einer der schönsten des deutschen Kinojahres.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Norbert Elias neu gelesen: Einsamkeit der Sterbenden im 21. Jahrhundert 4:09
4:09  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai4:09
Menyukai4:09
Kann man den Tod austricksen? Jetzt vielleicht noch nicht, aber in naher Zukunft vermutlich schon irgendwie, zumindest eine Zeitlang. Dies glauben inzwischen nicht nur autokratische Machthaber wie Vladimir Putin und Xi Jinping, sondern eine immer größer werdende Bewegung der Schönen und Reichen. Unter dem Schlagwort „Longevity“, also Langlebigkeit , hoffen heute immer mehr Menschen, dem Tod ein Schnippchen schlagen zu können, im Vertrauen auf Fortschritte in Medizin und Wissenschaft. Gesichtslose Apparatemedizin Norbert Elias hätte diese Wiederbelebung des alten Traums von der Unsterblichkeit nicht überrascht. Tatsächlich hat der deutsch-britische Soziologe sie schon Anfang der achtziger Jahre vorhergesehen, in seinem epochalen Essay „Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen“. Darin konstatiert Elias mit nüchternem Blick, wie sehr der Tod in der modernen Gesellschaft einer kollektiven Verdrängung anheimfalle. Weshalb alles, was mit Tod und Sterben zu tun habe, von uns tunlichst tabuisiert werde. Und zwar nicht nur vor Kindern. Auch wir selbst täten alles, um nicht an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert zu werden, und mieden etwa den Kontakt zu Sterbenden. War der Tod früher etwas Alltägliches – so alltäglich, dass die Menschen oft zuhause im Kreis ihrer Angehörigen aus dem Leben scheiden konnten –, so würden die Sterbenden in modernen Gesellschaften einer ausufernden, gesichtslosen Apparatemedizin überlassen werden. Isoliert und geräuschlos Noch nie starben Menschen so geräuschlos und hygienisch wie heute in diesen entwickelteren Gesellschaften und noch nie unter sozialen Bedingungen, die in so hohem Maße die Einsamkeit befördern. Quelle: Norbert Elias: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen Wenige Jahre nach Corona, als so viele Infizierte komplett isoliert von ihren Angehörigen in Kliniken oder Pflegeheimen sterben mussten, lesen sich Beobachtungen wie diese zwangsläufig mit ungleich größerer Betroffenheit. Die nun erschienene Neuausgabe von Norbert Elias’ Essay bietet aber auch unabhängig von den Pandemiejahren eine gute Gelegenheit, über die Haltbarkeit von Elias’ Thesen nachzudenken. Und damit auch über den Umgang mit Tod und Sterben im frühen 21. Jahrhundert. Allgegenwärtiger Tod in Medien Dieser scheint sich im Vergleich zum späten 20. doch in vielerlei Hinsicht geändert zu haben, im Guten wie im Schlechten. Stichwort Verdrängung: Wer sich dem Medienkonsum nicht komplett verweigert, wird heutzutage kaum um die Konfrontation mit dem Tod in all seinen Erscheinungsformen herumkommen. Zudem strotzt, wie Didier Eribon in seinem klugen Nachwort zur Neuausgabe richtig bemerkt, gerade unsere Gegenwartskunst nur so von Darstellungen von Alter und Sterblichkeit: von Filmen wie Michael Hanekes „Liebe“ bis zu literarischen Werken wie Helga Schuberts autobiografischer Erzählung „Der heutige Tag“ über das Leben mit ihrem pflegebedürftigen Mann bis zu seinem Tod. Vielleicht sollte man doch offener und klarer über den Tod sprechen, sei es auch dadurch, daß man aufhört, ihn als Geheimnis hinzustellen. Der Tod verbirgt kein Geheimnis. Er öffnet keine Tür. Er ist das Ende eines Menschen. Was von ihm überlebt, ist das, was er anderen Menschen gegeben hat, was in ihrer Erinnerung bleibt. Quelle: Norbert Elias: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen Sterbebegleiter ChatGPT Es ist nicht zuletzt Elias’ unbarmherziger Gesellschaftsdiagnose von 1982 zu verdanken, dass seit den späten neunziger Jahren die Hospizbewegung aufkam und einen menschenwürdigeren Umgang mit dem Sterben ermöglichte. Es sage also niemand, dass sich die Dinge nicht auch zum Besseren verändern können. Und wenn, wie Elias schreibt, der moderne Mensch Hemmungen hat, bei Besuchen bei Sterbenden die richtigen Worte zu finden – und deshalb den Besuch lieber gleich unterlässt –, so scheint auch darauf unsere Gegenwart eine Antwort zu wissen. Schließlich lassen sich schon jetzt immer mehr Menschen von den allgegenwärtigen KIs Liebes- oder Beileidsbriefe schreiben. Wenn man also gar nicht weiß, was man zu einem todkranken Angehörigen oder Freund sagen soll – ChatGPT weiß es bestimmt.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Nachhaltig und sozial: Wie das Steingauquartier ein Vorbild für Städte wird 3:55
3:55  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:55
Menyukai3:55
Hier ist kein Haus wie das andere. Schwarze Fassaden mit geschwungenen Balkonen stehen neben Holzfassaden, an denen Pflanzen hochranken. Daneben ein pistaziengrünes Gebäude, weiter hinten eines in Schwedenrot. Ein Spaziergang durchs Viertel zeigt: Hier wurde mit Mut zur Vielfalt gebaut – und mit dem Wunsch, Gemeinschaft zu leben. Die Gemeinschaft. Das ist es, was das Steingau ausmacht. Jedes Haus sieht anders aus, und in den Innenhöfen können sich die Kinder frei bewegen Quelle: Steingauquartier-Bewohner Dass das möglich wurde, liegt an einer ungewöhnlichen Entscheidung der Stadt. Kirchheim hatte das Vorkaufsrecht für das Areal genutzt und den Baugrund anschließend gezielt an Baugruppen und Investoren weitergegeben, die bereit waren, sich an soziale und städtebauliche Vorgaben zu halten. Nicht der höchste Preis zählte, sondern der beste Beitrag zur Gemeinschaft. Ein Quartier mit Anspruch Wer hier bauen wollte, musste zeigen, wie das eigene Projekt zur Stadtgesellschaft beiträgt – sei es durch besondere Wohnformen, soziale Angebote oder gemeinschaftliche Nutzungskonzepte. Eine Architektur-Jury entschied über die Bewerbungen. Wir wollten zeigen, dass nachhaltige, soziale Quartiere nicht nur in Universitätsstädten funktionieren. Quelle: Stadtplaner Gernot Pohl „Wir haben hier Projekte, die besonders vielfältige Wohnangebote gemacht haben“, erklärt Stadtplaner Gernot Pohl, Abteilungsleiter für Städtebau und Baurecht, „es gibt Penthouse- und Sozialwohnungen, Clusterwohnungen als moderne WGs, Pflege- und Demenz-Wohngemeinschaften oder auch Wohnungen, die bewusst unter Mietspiegel vermietet werden.“ Neben Wohnraum ist auch Platz für Arbeit und Begegnung entstanden. Rund 25 Gewerbebetriebe sind inzwischen im Steingau zuhause: von Arztpraxis und Fahrradanhänger-Manufaktur bis hin zu Cafés und kleinen Läden ist alles vorhanden. Es gibt Gemeinschaftsräume, eine Werkstatt fürs Quartier, Sportgruppen, Spieleabende und Krabbelgruppen. Etwa 800 Menschen leben mittlerweile hier. Ein Wohnzimmer für alle Im Herzen des Viertels liegt der neue Quartiersplatz mit Brunnen, Kletterelementen aus Naturstein und viel Grün. „Der Platz ist im Prinzip das Wohnzimmer des Viertels“, sagt Pohl. Hier treffe man sich, und rundherum entstehen nach und nach Gastronomien. Wer durch das Steingauquartier läuft, merkt schnell: Autos spielen hier kaum eine Rolle. Das gesamte Viertel ist mit hellen Steinen gepflastert, dazwischen wachsen Büsche und kleine Bäume. Nur neun Parkplätze gibt es, allerdings für die Gewerbebetriebe. Ein Vorbild für andere Städte 2018 begannen die Bauarbeiten, inzwischen sind die letzten Bauzäune gefallen. Was einst ein Experiment war, gilt heute als Modellprojekt für zukunftsfähige Stadtentwicklung. Delegationen aus dem In- und Ausland kommen regelmäßig, um sich das Konzept anzusehen. Pohl glaubt, dass der Erfolg auch anderswo möglich ist: „Wie jede Stadt ihre Themen übersetzt, muss sie selbst entscheiden. Aber das Beispiel zeigt, dass innovative Stadtviertel nicht nur in Tübingen oder Freiburg entstehen können, sondern überall, wo man es will.“ Das Steingauquartier ist ein Beweis mehr dafür, dass wenn Stadtplanung Raum für Vielfalt, Begegnung und Nachhaltigkeit lässt, entsteht ein Ort, an dem Menschen wirklich leben wollen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Comeback der Diddl-Maus – Jetzt sammeln die Erwachsenen 3:28
3:28  Putar Nanti
Putar Nanti  Putar Nanti
Putar Nanti  Daftar
Daftar  Suka
Suka  Menyukai3:28
Menyukai3:28
"Kidults" sind die neuen Sammler Große Ohren, riesige Füße, weißes Fell und schwarze Stupsnase: Die Diddl-Maus eroberte in den 90er-Jahren und frühen 2000ern Kinderzimmer und Schulhöfe. Knapp dreißig Jahre später kehrt die Maus zurück – als Sammelobjekt von Erwachsenen. Sogenannte "Kidults" (eine Zusammensetzung aus den englischen Begriffen "Kid" und "Adult") gelten mit ihrer Kaufkraft als wichtige, neue Zielgruppe der Spielwarenindustrie. Diddl-Tauschtreffen in Stuttgart Für Sammlerin Jasmin Einhauser bedeutet die Maus unter anderem die Rückkehr in warme Kindheitserinnerungen, aber auch das Erleben von Gemeinschaft. Etwa bei einem Diddl-Tauschtreffen in Stuttgart – dort wird auf aneinandergereihten Tischen alles präsentiert, was das Diddl-Sammler-Herz begehrt. Neben dicken Ordnern voller bunter Blätter und Blöcken in unterschiedlichen Größen gibt es unter anderem Stofftiere, Gläser, Stifte, Postkarten und Spiele. Dabei allgegenwärtig: Die berühmte 90er-Jahre-Maus und ihre Freunde. Diddl ist für mich so glücklich, so fröhlich, positiv Quelle: Jasmin Einhauser, Sammlerin „ Als Kind hat man so auf dem Schulhof irgendwie so hin und her getauscht und das war so ein positives Gefühl“, erinnert sich Jasmin Einhauser, Sammlerin und Organisatorin eines Diddl-Tausch-Events, das am Wochenende in Stuttgart stattfand. Für sie bedeutet Diddl ein Stück Kindheit, aber auch: „ Diddl ist für mich so glücklich, so fröhlich, positiv.“ Positive Gefühle aus der Kindheit zurückholen – in Zeiten globaler Krisen wie der Corona-Pandemie, Klimawandel und Kriegen scheint sich das immer mehr zum Trend zu entwickeln. Spielende Erwachsene sind salonfähig Neben Diddl erleben auch bekannte Spielzeugmarken wie Lego, Tamagotchi oder Barbie ein Revival. Mit blockbusterartigen Filmen, Sondereditionen und Neuauflagen sprechen sie aber nicht etwa Kinder, sondern gezielt erwachsene Menschen an. Für Spielzeug- und Spielforscher Volker Mehringer von der Universität Augsburg, Teil einer neuen Form des Erwachsenseins. Dieser Trend sei salonfähig geworden: als Erwachsener sich Spielzeug zu kaufen, ohne schräg angeschaut zu werden. Erwachsene entwickelten für sich wieder eine gewisse Begeisterung für Spielzeug, meint Mehringer. „Ich glaube, dass Spielzeug auch für Erwachsene total gut funktionieren kann und total reizvoll sein kann, dass es eher so eine gesellschaftliche Konvention ist“, so der Forscher. Man sei aus dem Spielzeugalter raus und das Thema solle nun durch sein, aber es verändere sich etwas: „Wir haben einen kleinen Zeitenwandel.“ Alltagsgefühle Erwachsener adressiert So knüpft das Diddl-Universum – in Hörspielen oder im „Käseblatt“, der markeneigenen Zeitschrift – an Alltagsgefühle an, die auch Erwachsene kennen: Neben Freude etwa Angst oder Liebe, erklärt Jasmin Einhauser. Es gebe auch diese „Frogbrothers“, eine Art Feinde, die Diddle ein bisschen ärgerten. Sie seien wie Kollegen, die man nicht mag. Das seien Themen, die auch Erwachsene im Alltag immer noch beträfen, sagt sie. Gefühle bewusst erleben, weich sein, spielen dürfen – die neue Zielgruppe der sogenannten „Kidults“, einer Zusammensetzung aus den englischen Begriffen „Kid“ und „Adult“ – gewinnt auch wirtschaftlich zunehmend an Relevanz. Reiz des Sammeln und Tauschens So erklärte eines der wichtigsten deutschen Branchenevents, die Spielwarenmesse in Nürnberg, Kidults bereits im vergangenen Jahr zu ihrem Schwerpunktthema. Der neue, alte, Diddl-Trend verbindet dabei positive Emotionen des Spielens und nostalgischen Erinnerns mit dem Reiz des Sammeln und Tauschens. Fast schon ein „Flow“, sagt Sammlerin Jasmin Einhauser und dabei vergesse man, was drumherum passiere. Denn „man guckt: Habe ich das schon und wie sieht das aus und ja, man tut es in seine Sammlung rein und dann ist man irgendwie total glücklich.“ Getauscht, gesammelt und vernetzt wird sich inzwischen aber auch digital. Etwa über Plattformen wie Kleinanzeigen, Vinted, Facebook-Marketplace oder in Chatgruppen. Dabei erfüllt das Sammeln auch eine soziale Funktion, sagt der Spielforscher Volker Mehringer.Das Sammeln erzeugt eine Gemeinschaft. Sammeln biete einerseits eine gewisse Gemeinschaft , so der Forscher, anderseits aber auch „eine Möglichkeit zur Individualisierung. Das heißt, ich habe besondere Sammlerstücke, die die anderen vielleicht nicht haben.“ Sammlung mit 7000 Diddl-Mäusen Neben alten Postkarten, Blechdosen oder seltenen Auflagen gehören dazu auch besonders große Sammlungen. Wie die einer Teilnehmerin mit knapp 7000 Diddl-Kuscheltieren. Welche Sammlerstücke dabei noch fehlen, wird mit Hilfe von Listen dokumentiert. Was nicht mehr gebraucht wird, wird angeboten. Jasmin Einhauser: „ Also ich habe zum Beispiel eine ziemlich große Sammlung, die ich doppelt habe oder Sachen, die ich nicht sammle. Ich sammle zum Beispiel keine Kuscheltiere. Aber wenn jemand anders damit glücklich wird, dann gebe ich das natürlich voll gerne her gegen etwas, was ich noch sammle.“…
Selamat datang di Player FM!
Player FM memindai web untuk mencari podcast berkualitas tinggi untuk Anda nikmati saat ini. Ini adalah aplikasi podcast terbaik dan bekerja untuk Android, iPhone, dan web. Daftar untuk menyinkronkan langganan di seluruh perangkat.